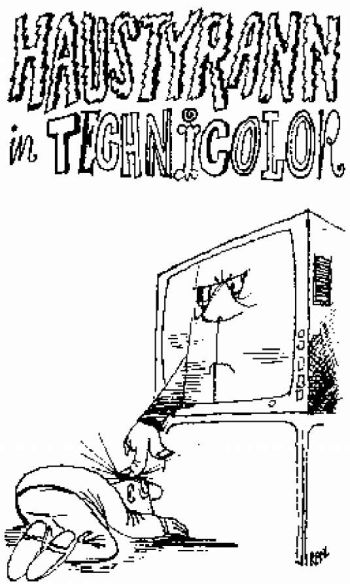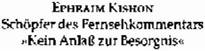Schallplatten ohne Schall
So muß ich Jahr für Jahr eine neue Platte kaufen, und dazu schickte ich mich auch diesmal wieder an. Die gewaltige Anzahl der inzwischen auf den Markt geworfenen Produkte ließ mich erbleichen.
»Entschuldigen Sie«, wandte ich mich an eine der Verkäuferinnen, ein anmutiges junges Mädchen, und wies auf einen Plattenumschlag, der unter dem Titel »Gezwitscher aus dem Wienerwald« ein anmutiges junges Mädchen auf einer Waldlichtung zeigte. »Was ist das?«
»Das ist eine Orginalaufnahme aus dem Wienerwald«, antwortete das anmutige Mädchen hinter dem Verkaufspult. »Hauptsächlich für Städter, die zu Hause gerne ein wenig Vogelgezwitscher hören möchten. Eine volle Stunde Zirpen und Zwitschern, Stereo. Wollen Sie es haben?«
»Eigentlich nicht«, gab ich zurück. »Mir genügt das Zirpen und Zwitschern meines Töchterchens Renana.«
Eine weitere Durchsicht des aufgehäuften Materials förderte immer unwahrscheinlichere Extreme zutage.
Das Feld der klassischen Musik mit all seinen Langspiel-Opern, Symphonien, Ouvertüren und Oratorien ist ja längst abgegrast, Jazz, Beat und Pop haben ihre Ein-Stunden- Schuldigkeit getan, Chöre, Sängerknaben, Wunderkinder und liturgische Gesänge sind von Tanz- und Turnplatten abgelöst worden. Jetzt hält man bei Bestsellern in Prosa und bei den großen Dramen der Weltliteratur.
»Vielleicht wollen Sie zu Hause den Hamlet spielen?« fragte das anmutige Mädchen. »Wir haben gerade die einstündige Langspielaufnahme der Old-Vic-Produktion hereinbekommen. Eine interessante Novität: Hamlets Text ist ausgespart, so daß ihn der Zuhörer selbst sprechen kann, und die größten englischen Schauspieler antworten ihm auf Stichwort…«
»Vielen Dank«, sagte ich. »Ich suche eine Platte für meine Frau.«
»Leider«, sagte die Anmutige. »Eine Ophelia-Ausführung haben wir nicht.«
Wir gingen durch die weiteren Vorräte und stießen auf »Nixons Rede in Ostberlin«, »Yehudi Menuhin liest das Alte Testament« und »Original-Tonaufnahmen von der Rennbahn in Ascot.«
»Halt – haben Sie vielleicht das Fußballmatch England gegen Ungarn?«
»Bedaure. Ausverkauft.«
Das anmutig Mädchen schlug mir eine Trappistenplatte vor: »Stille im Kloster von Grâce de Dieu«. Ich log ihr vor, daß wir diese Platte schon hätten. Und die Langspielplatte »Die Wiener Sängerknaben knabbern Erdnüsse« war zwar angekündigt, aber noch nicht ausgeliefert. Das Neue Jahr kam immer näher. Ich mußte eine Entscheidung treffen und entschied mich für etwas Politisches:
»Henry Kissinger denkt bei Harfenbegleitung nach.«
Stereo aus siebenter Hand
Da wir jedoch auf unsere gewohnte musikalische Erbauung nicht verzichten wollten, begannen wir uns vorsorglich nach einem Ersatz für das stillgelegte Gerät umzusehen, wobei uns klar war, daß wir uns nicht etwa an die Verkaufsinserate der Tagespresse halten durften, denn diese sind unzuverlässig. Statt dessen bat ich Freunde und Bekannte, ihre Augen offenzuhalten und uns zu benachrichtigen, falls sie etwas Passendes entdeckten.
Alsbald erschien unser Nachbar Felix Seelig mit froher Botschaft: »Ich hab’s!« verkündete er jauchzend. »Ein phantastischer Apparat, höchste Qualität, aus erster Hand. Allerdings nicht ganz billig. Der Besitzer verlangt 4000 Shekel. Überflüssig zu sagen, daß ich selbst mit keinem roten Heller beteiligt bin.«
»Laß es gut sein, Felix«, antwortete ich. »Wer ist der Besitzer?«
Felix ließ es gut sein und gab den Namen des Besitzers mit Uri an, und ich sollte nur ja nicht vergessen, ihm, Uri, zu sagen, daß er, Felix, mich geschickt hatte, vielleicht ginge Uri dann ein wenig mit dem Preis herunter. Außerdem sollte ich unbedingt die Worte »Felix fünf« hinzufügen. Nichts weiter, nur »Felix fünf«. Uri wüßte Bescheid.
Er war, als ich kam, leider nicht zu Hause, aber sein kleiner Bruder versprach mir, ihn zu verständigen. Tatsächlich erschien Uri am nächsten Tag bei mir in der Redaktion, wo er keine langen Umschweife machte: Da ich mit seinem Freund Felix befreundet sei, würde er selbst keinen roten Heller für sich beanspruchen, und der Plattenspieler koste nur 4300 Shekel.
»Felix fünf«, sagte ich vereinbarungsgemäß. »Felix fünf.«
»Das braucht Sie nicht zu kümmern«, beruhigte mich Uri. »Das macht keinen Unterschied. Es bleibt bei 4800.«
Damit übergab er mir einen verschlossenen Briefumschlag für einen gewissen Friedländer in Jaffa und wünschte mir viel Glück.
Jetzt griff mit blinder Gewalt das Schicksal ein. Die Nagelfeile der besten Ehefrau von allen geriet am Abend zufällig in die Nähe des Briefumschlags, glitt unversehens unter den dürftig gummierten Rand und nötigte mich somit, den Inhalt des Briefs zur Kenntnis zu nehmen. Es waren nur wenige Zeilen, gerichtet von Uri an Friedländer.
»Überbringer ist ein Freund von Felix. Sucht einen Stereo-Plattenspieler. Felix verlangt 500 Shekel. Ich bekomme 300 und eine Draufgabe für meinen kleinen Bruder, der die Sache vermittelt hat.«
Ich verschloß den irrtümlich geöffneten Brief und trug ihn am folgenden Morgen zu Friedländer nach Jaffa.
»Einem Freund von Uri bin ich immer gern gefällig«, sagte Friedländer. »Der Plattenspieler, den ich für Sie im Auge habe, ist ein wahrer Fund. Ich werde sofort meine Braut anrufen. Ihr Mann kennt den Besitzer.«
Friedländer begab sich ins Nebenzimmer und versperrte die Tür, aber einige Gesprächsfetzen drangen doch an mein Ohr: »Hallo, Liebling… alten Plattenspieler auftreiben… Uri will 400… ich möchte 300 haben… also gut, 200… wir müssen auch Mama beteiligen … und natürlich deinen Mann … alles klar.«
Anschließend gab mir Friedländer die Telefonnummer des Gatten seiner Braut – der, wie sich zeigte, Platzanweiser in einem Kino in Beersheba war – und erklärte mir, daß der Preis des Apparats ein wenig gestiegen sei, Inflation und so, das müßte ich verstehen, und ihm persönlich bringe die Sache keinen roten Heller. Nachts telefonierte ich mit Beersheba.
»Da Sie mit dem Bräutigam meiner Frau befreundet sind«, sagte der Platzanweiser, »bekommen Sie diesen hervorragenden Plattenspieler um 5700 Shekel.«
Ich nahm einen raschen Überschlag vor: Felix – 500. Uri 300. Kleinerer Bruder – 100. Friedländer – 200. Mama 50. Braut – 250. Platzanweiser – 100. Rechnete man den Apparat hinzu, der ja auch etwas kostete, so ergab sich eine Gesamtsumme von 5500 Shekel, nicht 5700. Auf die Differenz aufmerksam gemacht, führte mein neuer Geschäftspartner die Anwaltskosten seiner Scheidung von Friedländers Braut ins Treffen und meinte, daß für einen fabrikneuen Stereo-Plattenspieler selbst 5700 Shekel ein lächerlich geringer Preis wären. Meine zurückhaltende Reaktion veranlaßte den Platzanweiser, am nächsten Tag eigens aus Beersheba herüberzukommen, um den Kontakt zwischen mir und dem in Tel Aviv wohnhaften Besitzer des Apparates persönlich herzustellen.
»Der Idiot hat keine Ahnung von den Preisen, die jetzt gezahlt werden«, informierte er mich unterwegs. »Lassen Sie mich unter vier Augen mit ihm reden, und der Fall ist erledigt.«
An dieser Stelle erwachte mein Geschäftssinn. Ich erklärte, daß auch ich eine kleine Beteiligung haben möchte.
»Aber Sie sind doch der Käufer?« wunderte sich der Mann aus Beersheba.
»Macht nichts«, beharrte ich. »Schlagen Sie zum Preis noch 325 Shekel dazu, und die geben Sie mir dann unterm Tisch. Wenn alle beteiligt sind, will auch ich beteiligt sein.«
Wir hatten die angegebene Adresse erreicht. Meine Frau öffnete die Tür und führte uns zu dem Apparat, den wir, vielleicht erinnert man sich noch, loswerden wollten.
»Ein wunderbares Gerät!« flüsterte mir der Platzanweiser zu. »Warten Sie, bis ich mit der Dame gesprochen habe.«
»Sie können auch mit mir sprechen«, sagte ich. »Der Apparat gehört mir.«
»Schön. Was wollen Sie haben?«
»4000 netto.«
Nach einer kurzen Pause, die er für seine Kopfrechnung brauchte, erklärte sich der Platzanweiser einverstanden: »In Ordnung. Mit Freunden handle ich nicht. Ziehen Sie den Preis des Apparats, also 4000 Shekel, von der Gesamtsumme ab, zahlen Sie mir 2025 Shekel, und ich gebe Ihnen Ihre 325 Shekel zurück.«
Das war eine faire Lösung. Außerdem halte ich nichts davon, ein Geschäft scheitern zu lassen, an dem so viele Leute, noch dazu lauter gute Freunde, beteiligt sind. Es gelang mir, noch 25 Shekel für mich herauszuholen. Dann besiegelten wir den Abschluß der Transaktion mit einem Umtrunk.
Soundtrack total
Anschließend wurde ihnen die gleiche Szene mit Hintergrundmusik von Tschaikowsky vorgeführt. Ergebnis: lautes Schluchzen seitens der Anwesenden; zwei von ihnen richteten briefliche Heiratsanträge an die Prinzessin, einer emigrierte nach Schottland. Und das alles war das Werk dreier Violinen, zweier Flöten und eines Cellos. Ein komplettes Salonorchester hätte, wie die Experten sofort berechneten, mindestens drei Selbstmordversuche zur Folge gehabt. Bei Shakespeare heißt es, daß die Musik der Liebe Nahrung ist. Er meinte natürlich die Hintergrundmusik, das geht aus der betreffenden Szene in »Was ihr wollt« eindeutig hervor. Und diese nahrhafte Eigenschaft der Musik bewährt sich auch in anderen Zusammenhängen. Man wußte das schon zur seligen Stummfilmzeit, als der Repräsentant des Guten seinen schurkischen Widerpart noch zu Pferd verfolgte und der Klavierspieler ihn unweigerlich mit der »Leichten Kavallerie« von Suppe begleitete (in besseren Kinos spendierte man ihm die Ouvertüre zu Rossinis »Wilhelm Tell« ). Auch heute, da das Pferd von den Pferdekräften unter der Kühlerhaube verdrängt wurde, hat sich an diesem Prinzip im Grunde nichts geändert.
Die übliche Verfolgungsjagd in den Straßen von San Francisco wäre undenkbar ohne die erregenden Staccati einer Combo-Band, und Leutnant Kojak weiß sehr gut, daß seine Glatze nichts taugt, wenn sie nicht von Klarinetten überrieselt wird. Kein Unterseeboot darf ohne Trompetenklang auftauchen, kein Nelson verzichtet, wenn er Lady Hamilton trifft, auf Untermalung durch Gitarrenklänge.
Genauer besehen gab es das alles sogar vor der Erfindung des Kinos, vom Fernsehen ganz zu schweigen. Die Kirche, weitblickend wie immer, entdeckte als erste die Wechselbeziehung zwischen Musik und höheren Gefühlsaufwallungen – oder warum hätte sie die Orgel samt Johann Sebastian Bach für himmlische Zwecke beschlagnahmt? Wir dürfen weiters auf das alte Brauchtum verweisen, demzufolge Staatsoberhäupter – gekrönt oder nur gewählt, gewählt oder nur gekrönt – ihren Fuß erst dann auf den roten Teppich setzen, wenn sie sich vergewissert haben, daß dazu die markige Marschmusik einer Militärkapelle ertönen wird.
Indessen ist nicht nur Musik, wie schon erwähnt, der Liebe Nahrung, sondern die Nahrung als solche profitiert ihrerseits von der Musik. Die Oberkellner vornehmer Restaurants werden bestätigen, daß der Gast für sich und seine Begleiterin viel kostspieligere Speisen bestellt und daß er der Rechnung viel geringere Aufmerksamkeit zuwendet, wenn im Hintergrund der beliebte Barpianist Charlie »Ich küsse Ihre Hand, Madame« klimpert. Ähnlich günstige Meldungen kommen aus der Industrie. Fabriken, die ihre Arbeiter mit Schallplattenmusik versorgen, werden seltener und kürzer bestreikt. Eine Ausnahme bildet lediglich die Schallplattenindustrie.
Gedanken solcher Art gingen mir durch den Kopf, als ich meiner zuständigen Steuerbehörde auf ihren Wunsch einen Besuch abstattete. Die Behörde amtiert im 14. Stockwerk des Finanzministeriums, und während man mit dem Aufzug zu ihr emporstrebt, säuselt ein unsichtbarer Lautsprecher diskret ergreifende Zionslieder, die von unserer Heimkehr nach Jerusalem und unserer nach Jahrtausenden wiedererrungenen Freiheit singen und sagen. Damit soll auf dem Weg zur Nationalkassa der Patriotismus des kleinen Steuerzahlers geweckt werden. Da ich guten Einfällen immer zugänglich bin, beschloß ich, diese Idee auch für mich nutzbar zu machen. Wenn der Steuerprüfer das nächstemal meine Einkommensteuererklärung für den Zeitraum 1980-1986 einer Kontrolle unterzieht, werde ich taktvoll und unauffällig eine Tonbandkassette auf seinen Schreibtisch praktizieren und ihm das Leitmotiv aus »Dr. Schiwago« vorspielen, das mit den vielen Balalaikas. Er wird, wenn noch ein Funken Menschlichkeit in ihm schlummert, nicht über das Jahr 1982 hinauskommen.
Wirklich, warum sollte dem einzelnen Bürger – den man doch immer wieder auffordert, Privatinitiative zu entfalten – die Verwendung von Hintergrundmusik verwehrt sein? Was dem alten Sam Goldwyn recht war, ist mir billig, zumal seit es diese wohlfeilen kleinen Kassettenrecorder gibt, die man bequem in der Tasche tragen und überall durch den Zoll schmuggeln kann. Es führe jeder Bürger fortan seine eigene Hintergrundmusik mit sich und gebrauche sie im Umgang mit dem Steuerprüfer, dem Zivilrichter, dem Schuhverkäufer und vor allem im Umgang mit dem weiblichen Geschlecht.
Hier eröffnen sich besonders verheißungsvolle Perspektiven, und hier hat die moderne Jugend einen gewaltigen Vorteil vor dem Junggesellen von einst, der auf den altväterlichen, statischen Plattenspieler angewiesen war. Das Instrument des jungen Mannes von heute ist das Sexophon. Er nimmt seine Tonkassette mit auf die Parkbank, und während er mit der einen Hand dem Geheimnis der Knöpfe auf Ruthis Bluse nachforscht, stellt er mit der anderen Hand etwas Zweckdienliches von Chopin oder Clayderman ein. O glückliche Transistorgeneration! Wäre zu meiner Zeit das Tonband schon erfunden gewesen – ich hätte mindestens viermal geheiratet.
Kein Zweifel: die Zukunft gehört der Hintergrundmusik. Bald werden die Bankräuber, während sie ihre Beute einstreifen, Schalterbeamte und Kunden vermittels schmissiger Operettenpotpourris vor unbedachten Nervositätsausbrüchen bewahren, und die nächste Sammelaktion der »Jewish Agency« wird ungeahnte Summen abwerfen, weil den Spendern beim Ausschreiben des Schecks »A jiddische Mamme« mit Vibrato ins Ohr geträufelt wurde… Und Sie selbst, lieber Leser: Haben Sie daran gedacht, zur Lektüre dieser kleinen Abhandlung eine passende Hintergrundmusik einzuschalten? Nein? Dann lesen Sie das Ganze noch einmal zum Klang der neuesten »Rolling Stones«. Und sobald Sie zur Schlußpointe kommen, drehen Sie auf volle Lautstärke. Jetzt! Vielen Dank.
Die vollautomatische Seuche
Als ich noch ein kleiner Junge war, da gab es nichts auf der ganzen Welt, das ich lieber getan hätte als fotografieren. Aber leider hatte ich keine Kamera, denn sie war noch nicht erfunden worden. Oder doch, irgend etwas gab es schon, eine Art von schwarzem Schuhkarton, aus dem man eine Ziehharmonika hervorholen konnte. Gefüttert wurde das Unding nicht mit Film, sondern mit irgendwelchen Glasplatten, die die unangenehme Neigung hatten zu zerbrechen, bevor man noch ein Bild daraus machen konnte. Der Akt des Fotografierens stellte hohe geistige Anforderungen an den Lichtbildner. Er mußte immer kurz vor dem Knipsen in sprühende Laune ausbrechen:
»Alles herschauen, gleich kommt da ein Vögelchen heraus!«
Aus unerfindlichen Gründen konnte man mit solchen Aussprüchen Menschen zum Lachen bringen. Danach allerdings mußte der Fotograf bis zehn zählen, was zur Folge hatte, daß das Lachen vollkommen einfror. In dieser eben geschilderten Steinzeit der Lichtbildkunst pflegte man diesen schwarzen Schuhkarton noch nicht Kamera zu nennen, sondern »Box«, wenn er aus Deutschland, und »Kodak«, wenn er aus Amerika kam. Was die Japaner betrifft, so waren sie in jenen goldenen Tagen noch mit dem Fischen von Fischen präokkupiert.
Besagte Japaner fischen noch immer. Nur heutzutage verwenden sie Kameras als Köder, und die Beute sind wir. Ich selbst wurde vor gar nicht so langer Zeit geangelt, als mein Auge auf ein farbenprächtiges Inserat fiel:
»Ab jetzt können Sie mit geschlossenen Augen knipsen! Endlich ist sie da! Eine vollautomatische Kamera, die für Sie denkt!«
Na also, dachte ich mir. Ich falle nämlich prinzipiell auf alles herein, was automatisch ist, weil ich von Natur aus faul bin. Außerdem hatte ich immer schon eine Abneigung gegen das Denken, denn es macht mich müde. Kurz, ich ging hin und kaufte das kleine Wunderding mit geschlossenen Augen. Sehr bald entdeckte ich, daß meine neue Kamera einen abnormal hohen Intelligenzquotienten besaß. Sie konnte das Licht messen und die Blende verstellen, sie konnte ebenso perfekt die Entfernung einstellen und den Film weiterspulen, automatisch Motive finden und losknipsen, ohne mich um Erlaubnis zu fragen. Das Ding hatte etliche Mikroprozessoren in seinem Bauch, womit eigentlich alles erklärt wäre, unter anderem auch, warum es mir ständig ein Minderwertigkeitsgefühl vermittelte.
Ich hegte immer noch eine stille Hoffnung, daß mir mein kleiner Alleswisser wenigstens gestatten würde, den Auslöser zu betätigen, wie ich es von meinen alten Modellen gewohnt war. Doch es stellte sich heraus, daß auf meine diesbezüglichen Gelüste keine Rücksicht genommen wurde. Kein Auslöser war zu betätigen, es gab nichts zu knipsen. Meine einzige Aufgabe bestand darin, mit irgendeiner Fingerspitze an einem roten Sensor anzukommen, und mein japanischer Kamerad besorgte den Rest.
*
»Manchmal frage ich mich wirklich, wozu ich noch da bin«, teilte ich der besten Ehefrau von allen mit, während ich von ihr in der Küche einige beiläufige Schnappschüsse machte. »Ich komme mir so blöd vor wie ein werdender Vater während der Geburtswehen seiner Frau.«
»Das bist du auch«, sagt die beste Ehefrau von allen.
»Ich habe dir schon einige Male gesagt, daß ich keine Fotos von mir beim Geschirrspülen brauche, und schon gar nicht sechs Dutzend. Also schau, daß du rauskommst.«
Woraus zu entnehmen ist, daß meine Familie nicht bereit ist, meine Fotografierleidenschaft zu teilen. Oder zumindest nicht zehn Stunden pro Tag. Natürlich leide ich unter dieser Verständnislosigkeit. Man muß doch bitte Rücksicht darauf nehmen, daß ein Mensch eine neue Kamera hat. Er muß doch auch irgend etwas knipsen, oder?
Wir begannen, mein Roboter und ich, am häuslichen Herd. Dann gingen wir auf die Stühle über, Profil und en face. Als nächstes machten wir uns über die Bilder an der Wand her, worauf wir uns auf Franzi, unsere Hündin, stürzten, um schließlich, wie erwähnt, einige Familienserien zu kreieren. Letzteres bedingte einige Gewaltmaßnahmen meinerseits, aber das ist letzten Endes der Preis, den man für demokratische Mitbestimmung zu bezahlen hat.
»Vati«, sagte meine Tochter Renana, während ich sie gerade verewigte, beziehungsweise ihre Beine, da der Rest von ihr anläßlich einer Kopfwäsche im Waschbecken verschwunden war, »ich glaube, daß du einen Vogel hast.«
Vogel oder nicht, darauf konnte ich keine Rücksicht nehmen. Ich war zu diesem Zeitpunkt unsterblich in meine Kamera verliebt. Ich bewunderte den roten Sensorknopf, das flinke Klicken des automatischen Verschlusses sowie das professionelle Surren des mikroprozessorengesteuerten Motors. Alles an dieser Kamera riß mich zu Begeisterungsstürmen hin. Mit Ausnahme der Ergebnisse. Ich meine die Bilder, beziehungsweise das, was im Labor aus meinen Negativen gemacht wurde.
Die Bilder kamen per Post. Mengen und Unmengen in großen Paketen. Mir verursachten sie Enttäuschung, dem Rest meiner Familie Heiterkeit. Nicht daß es schlechte Bilder gewesen wären. Im Gegenteil, es waren auf ihre vollautomatische Art sogar sehr gute Bilder. Aber, wie soll ich es nur sagen, sie waren irgendwie uninteressant. Die Tische waren einfach Tische, die Stühle waren Stühle, Renana war Renana, und die Hündin war Franzi. Irgend etwas fehlte, das gewisse Etwas, die Aussage.
»Diese Kamera ist technische Zauberei, aber sonst nichts«, entschuldigte ich mich bei meinen Freunden, während ich sie durch die Stadt begleitete, um von ihnen Schnappschüsse zu machen. »Die Bilder, die da herauskommen, sind unheimlich einfallslos. Das Ergebnis ist bestenfalls ein Leonardo da Vinci, aber niemals ein echter Beuys…«
Meine Freunde blickten auf ihre Uhren und sagten mir, daß sie es eilig hätten. Also bat ich sie, noch schnell von mir ein Bild zu knipsen, und zwar mit der Frau Gemahlin. Und dann mit den Kindern. Und mit Franzi. Und jetzt alle zusammen. Dann sagte ich, das wäre wirklich das letzte Bild – Ehrenwort! – nur schnell noch ein Gruppenbild von euch allen da drüben, wo die Sonne scheint. Und noch ein allerletztes, wo ich auch drauf bin. Wartet, bis ich den Selbstauslöser eingestellt habe… In diesen Tagen habe ich viele Freunde verloren.
Was die vielen Fotos betrifft, es sind inzwischen etliche tausend geworden, so klebte ich die besten davon, Negative und Vergrößerungen gesondert, in etliche japanische Fotoalben. Selbstverständlich habe ich bei jedem Bild genau notiert, wann und wo es aufgenommen wurde, die Blendenzahl sowie die Belichtungszeit, wozu, weiß ich nicht.
Die nicht so ganz erstklassigen Bilder sandte ich mit freundlichen Grüßen an die Leute, die auf den Bildern zu sehen waren. Seltsamerweise bekam ich nie eine Antwort. Also verschickte ich die erstklassigen Bilder und klebte die nicht so ganz besonders guten in die japanischen Alben, doch ich bekam noch immer keine Antwort. Danach ging ich wieder dazu über, die weniger guten Bilder loszuschicken, aber schon ohne freundliche Grüße. Einige dieser Bilder kamen wieder zurück mit dem Vermerk: »Adressat verweigert Annahme.« Somit gab ich den erniedrigenden Postversand meiner Bilder auf und stopfte sie einfach in meine Taschen, um sie jedem, der mir über den Weg lief, zeigen zu können. Meine Freunde begannen, beim Anblick meiner Person zu erschauern, aber das ist ihr Problem.
Auch die Hündin begann mir aus dem Weg zu gehen. Wann immer Franzi witterte, daß ich ihr mit meinem Roboter nachzustellen beabsichtigte, zog sie den Schwanz ein und verkroch sich unter dem Bett. Ich mußte sehr hochempfindlichen Film verwenden, um sie dort knipsen zu können.
Die beste Ehefrau von allen hingegen entfernte eines Tages alle ihre Bilder aus meinen Alben und verbrannte sie im Garten. Wenn ich ehrlich sein will, kann ich ihr daraus keinen wirklichen Vorwurf machen. Während die Bilder, die ich von mir selbst schoß, einer Ein-Mann-Verbrecher-Galerie ähnelten, erinnerten die Fotos, die ich von der besten aller Ehefrauen machte, irgendwie an jene kleinen Geschöpfe, die man zu sehen bekommt, wenn man im Garten einen großen Stein aufhebt. Auch die Bilder, die ich von andern Leuten machte, trugen das Stigma der totalen Automation. Es war immer dieselbe steife Pose mit vielen Zähnen, immer dasselbe dumme Lächeln eines Totenschädels mit dem gewissen »Na, mach schon!« im Blick. Zum Berühmtwerden waren sie alle miteinander nicht geeignet, wenn auch einige dieser Bilder einen gewissen Hauch von Surrealismus verrieten. Zum Beispiel jenes, wo der Kopf von Felix Seelig aus dem Körper von Franzi herauszuwachsen schien. Vermutlich war es ein Defekt im Aufziehmechanismus. Es kann aber auch sein, daß die Batterie schon schwach war, oder temporäre Geistesschwäche oder sonst was.
Was Wunder also, daß ich das Sortieren und Einkleben meiner Bilder etwas vernachlässigte. Der endlose Strom von Fotografien war ganz einfach nicht mehr zu bewältigen. Also ging ich zu einem anderen System der Aufbewahrung über. Ich warf die Pakete, so wie sie der Briefträger brachte, in die Schuhablage bei der Eingangstür, ohne sie überhaupt anzusehen. Sie sehen ohnehin alle gleich aus.
Hin und wieder kommt mir der Gedanke, daß ich wenigstens vorübergehend aufhören sollte, Bilder zu knipsen. Aber meine Kamera ist, wie erinnerlich, eine vollautomatische und pflegt mich nicht zu fragen. Vorige Woche war die beste Ehefrau von allen einem Wutanfall nahe.
»Genug!« brüllte sie. »Ich dulde es nicht mehr, daß du auch nur ein einziges Bild von mir machst! Wenn ich wissen will, wie ich aussehe, kann ich in den Spiegel blicken…«
Also schoß ich eine Serie von ihr durch den Spiegel. Ferner beschlagnahmte ich zwei weitere Schubfächer im Vorzimmer. Tatsache ist, daß auch ich ein bißchen nervös werde. Es scheint, daß ich nicht mehr dieser ausgeglichene Mensch bin, der ich noch vor vierzig Jahren war. Freitag nacht zum Beispiel erschien mir ein greises Skelett im Traum.
»Ich bin der Tod«, stellte er sich vor. »Ich bin gekommen, um dich mitzunehmen, Ephraim. Hast du irgendeinen letzten Wunsch?«
»Ja, bitte«, sagte ich, »ich möchte Sie fotografieren.«
Er ergriff sogleich die Flucht. Dank meines automatischen Schnellaufzugs ist es mir gelungen, ein halbes Dutzend Bilder von ihm zu schießen. Gestern kamen die Abzüge. Er sieht genauso aus wie jeder andere. Dieselbe steife Pose, dasselbe dumme Lächeln, derselbe Totenschädel. Auch er schien zu denken: Na mach schon! Danach gab ich es auf. Vielleicht liegt es daran, daß ich mich für die automatische Fotografie nicht mehr eigne. Demnächst werde ich meine denkende Kamera verkaufen. Und eine neue erwerben. Möglichst mit einem automatischen Sensor, den ich nicht mehr berühren muß. Er berührt mich.
Schnappschütze
»Aufnahme?«
Im allgemeinen komme ich den Angehörigen freier und insbesondere künstlerischer Berufe freundlich entgegen, nicht nur, weil sie ihr Brot durch harte Arbeit verdienen, sondern weil sie sehr leicht ausfällig werden, wenn man ihre Bestrebungen nicht unterstützt.
Deshalb sagte ich mit aller mir zu Gebote stehenden Milde:
»Nein, danke.«
»Drei Postkarten vier Shekel«, antwortete der Fotograf und ging in Schnappschußposition. »Legen Sie den Arm um Ihre Frau, und Sie bekommen das schönste Familienporträt.«
Durch unmißverständliche Zeichen forderte er die neben mir sitzende Dame auf, ein frohes Lächeln zur Umarmung beizusteuern.
»Einen Augenblick!« rief ich. »Erstens habe ich Ihnen gesagt, daß ich keine Aufnahme haben will, und zweitens ist diese Dame nicht meine Frau. Ich kenne sie gar nicht.«
Die Unbekannte, die mich bereits heftig umschlungen hielt und ebenso heftig in die Kamera grinste, ließ sichtlich gekränkt von mir ab. Nicht so der Fotograf:
»Zwei Bilder matt sechs mal neun kosten nur 3,50, wenn Ihnen das lieber ist. Vielleicht wollen Sie einen Handstand machen?«
»Nein. Und lassen Sie mich endlich in Ruhe.«
»Warum?«
»Was heißt warum? Weil ich nicht fotografiert werden will!«
»Ein Erinnerungsbild zum Einkleben ins Album um lumpige 2,70. Auf Glanzpapier. Acht mal vierzehn. Sie können’s auch einrahmen lassen.«
»Ich will nichts einrahmen und ich will nichts einkleben. Ich will, daß Sie mich in Ruhe lassen.«
»Die Badesaison geht zu Ende. Drei Abzüge matt vier mal acht um 2,50.«
»Nein!! Ich bin nicht neugierig auf mich.«
»Das sehe ich ein. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, Herr. Sie brauchen jetzt nichts zu zahlen. Sie zahlen erst, wenn die Bilder fertig sind. Zwei matt elf mal fünf.«
»Nein, zum Teufel! Schauen Sie, daß Sie weiterkommen.«
»Schon gut, schon gut. Warum sagen Sie nicht gleich, daß Sie nicht geknipst werden wollen? Ich habe keine Zeit, mit Ihnen zu debattieren.«
Er entfernte sich ungehalten. Ich mietete einen Liegestuhl, streckte mich aus und schloß die Augen. Nach einer kleinen Weile überkam mich jenes unangenehm kribbelnde Gefühl, das sich immer dann einstellt, wenn man mit geschlossenen Augen in einem Liegestuhl liegt und fotografiert werden soll. Infolgedessen öffnete ich die Augen und sah den Fotografen dicht vor mir, Kamera in Stellung, Finger am Abzug.
»Schon wieder?! Verstehen Sie denn kein – k’k – Hebräisch?«
Das »k’k« rührte nicht etwa von einem plötzlichen Schluckauf her, sondern vom meuchlings betätigten Auslöser der Kamera.
Ich erhob mich und trat auf den Heckenschützen zu:
»Sie wußten doch, daß ich nicht fotografiert werden will.
Warum haben Sie es trotzdem getan?«
»Aus künstlerischen Gründen«, antwortete mein Widersacher, während er sein Gerät versorgte. »Es war eine so schöne Abendbeleuchtung und ein so interessanter Schatten auf Ihrem Gesicht.«
»Ist Ihnen klar, daß ich das Bild nicht kaufen werde?«
»Habe ich Sie gebeten, es zu kaufen?«
»Ohne meine Zustimmung hätten Sie mich gar nicht aufnehmen dürfen. Auch aus künstlerischen Gründen nicht.«
»Das können Sie mir nicht verbieten. Künstler dürfen sich in diesem Land frei betätigen. Wir leben in einer Demokratie.«
»Möglich. Aber ich bin kein Modell.«
»Sind Sie aus Polen?«
»Nein.«
»Dann bestellen Sie drei Abzüge, sieben mal dreiundzwanzig, Glanzpapier, fünf Shekel.«
»Nein! Verschonen Sie mich!«
»Dreizehn mal sechs?«
Er zielte – ich ließ mich zu Boden fallen – k’k – der Schnappschuß verfehlte mich – ich sah seine blutunterlaufenen Augen und faßte Mut – rannte zum Bassin – er hinter mir her – ich springe ins Wasser – k’k – er mir nach – ich tauche – er versucht eine Unterwasseraufnahme – ich entwische ihm – tauche auf – klettere an Land – sause zu meinem Lehnstuhl und bedecke mein Gesicht mit einem Badetuch. Es ist still.
Aber ich fühle, daß der schnappschußfreudige Gangster wieder vor mir steht. Unendlich langsam kriecht die Zeit dahin. Eines ist klar: Wenn das Badetuch verrutscht und auch nur einen Zentimeter meines Gesichts freigibt, schießt er.
Ich beginne zu schnarchen. Vielleicht täuscht ihn das.
Plötzlich fühle ich, daß jemand an meinem Badetuch zieht.
Ohne im Schnarchen innezuhalten, wende ich blitzschnell den Kopf und beiße in die fremde Hand.
»Auweh!« Eine dicke Dame schreit vor Schmerz laut auf. »Ich hab geglaubt, Sie sind mein Sami.«
Und noch dazu ein abermaliges k’k. Ich springe auf und zerschmettere ihm die Kamera. Das heißt: Ich will sie zerschmettern. Aber er muß etwas geahnt haben. Und jetzt bin’s ich, der ihn verfolgt.
»Drei… neun mal zehn… 1,50…« ruft er mir über die Schulter zu.
»Nicht einmal … wenn Sie… bezahlen…«
»Ein Shekel… matt…«, röchelt er im Rennen und streut dabei kleine weiße Kärtchen um sich. »Die Adresse… meines Ateliers … täglich geöffnet… Kinder die Hälfte… auch in Farbe… sechzehn mal einundzwanzig…«
Der verzweifelte Sprung, mit dem ich ihn knapp vor dem Ausgang abzufangen versuche, kommt zu spät.
Er ist draußen. Und ich kann ihm nicht folgen, ohne öffentliches Ärgernis zu erregen.
Gestern ging ich ins Atelier. Warum auch nicht. Ich meine: Warum soll ich nicht ein paar von den Bildern kaufen, vielleicht sind sie ganz gut geworden. Man sagt mir, daß ich sehr fotogen bin, und die beste Ehefrau von allen wird sich bestimmt freuen, wenn sie mich in einer ungezwungenen Pose zu sehen bekommt.
Der Fotograf begrüßte mich wie einen alten Freund, aber er hatte leider kein einziges Foto von mir. Es sei, so erklärte er verlegen, professionelle Gepflogenheit, die ersten Schnappschüsse immer mit einer leeren Kamera zu machen. Der Film wird erst eingelegt, wenn die Kundschaft weichgeklopft und zur Aufnahme bereit ist.
Ich bedauerte seine vergebliche Mühe, er bedauerte meine Enttäuschung. Ich würde eine kleine Geschichte darüber schreiben, tröstete ich ihn zum Abschied.
»Wie klein?« fragte er.
»Fünf mal acht«, sagte ich. »Matt.«
HAUSTYRANN IN TECHNICOLOR
Fernsehen als Erziehungsanstalt
»Wunder dauern höchstens eine Woche«, heißt es im Buche Genesis. Wie wahr!
Nehmen wir zum Beispiel das Fernsehen: Während der ersten Wochen waren wir völlig in seinem Bann und saßen allnächtlich vor dem neu erworbenen Gerät, bis die letzte Versuchsstation im hintersten Winkel des Vorderen Orients ihr letztes Versuchsprogramm abgeschlossen hatte. So halten wir’s noch immer – aber von »gebannt« kann keine Rede mehr sein. Eigentlich benützen wir den Apparat nur deshalb, weil unser Haus auf einem freiliegenden Hügel steht; und das bedeutet guten Empfang von allen Seiten.
Dieser Spielart des technischen Fortschritts ist auch Amir zum Opfer gefallen. Es drückt uns das Herz ab, ihn zu beobachten, wie er fasziniert auf die Mattscheibe starrt, selbst wenn dort eine Stunde lang nichts andres geboten wird als das Inserat »Pause« oder »Israelische Television«. Etwaigen Hinweisen auf sein sinnloses Verhalten begegnet er mit einer ärgerlichen Handbewegung und einem scharfen »Psst!«
Nun ist es für einen Fünfjährigen nicht eben bekömmlich, Tag für Tag bis Mitternacht vor dem Fernsehkasten zu hocken und am nächsten Morgen auf allen Vieren in den Kindergarten zu kriechen. Und die Besorgnisse, die er uns damit verursachte, sind noch ganz gewaltig angewachsen, seit der Sender Zypern seine lehrreiche Serie »Die Abenteuer des Engels« gestartet hat und unsern Sohn mit schöner Regelmäßigkeit darüber unterrichtet, wie man den perfekten Mord begeht. Amirs Zimmer muß seither hell erleuchtet sein, weil er sonst vor Angst nicht einschlafen kann. Andererseits kann er auch bei heller Beleuchtung nicht einschlafen, aber er schließt wenigstens die Augen – nur um sie sofort wieder aufzureißen, aus Angst, daß gerade jetzt der perfekte Mörder erscheinen könnte.
»Genug!« entschied eines Abends mit ungewöhnlicher Energie die beste Ehefrau von allen. »Es ist acht Uhr. Marsch ins Bett mir dir!«
Der als Befehl getarnte Wunsch des Mutterherzens ging nicht in Erfüllung. Amir, ein Meister der Verzögerungstaktik, erfand eine neue Kombination von störrischem Schweigen und monströsem Gebrüll.
»Will nicht ins Bett!« röhrte er. »Will fernsehen. Will Fernsehen sehen!«
Seine Mutter versuchte ihn zu überzeugen, daß es dafür schon zu spät sei. Umsonst.
»Und du? Und Pappi? Für euch ist es nicht zu spät?«
»Wir sind Erwachsene.«
»Dann geht arbeiten!«
»Geh du zuerst schlafen!«
»Ich geh schlafen, wenn ihr auch schlafen geht.«
Mir schien der Augenblick gekommen, die väterliche Autorität ins Gespräch einzuschalten:
»Vielleicht hast du recht, mein Sohn. Wir werden jetzt alle schlafen gehen.«
Ich stellte den Apparat ab und veranstaltete gemeinsam mit meiner Frau ein demonstratives Gähnen und Räkeln. Dann begaben wir uns selbdritt in unsere Betten. Natürlich hatten wir nicht vergessen, daß Kairo um 20.15 Uhr ein französisches Lustspiel ausstrahlte. Wir schlichen auf Zehenspitzen ins Fernsehzimmer zurück und stellten den Apparat vorsichtig wieder an.
Wenige Sekunden später warf Amir seinen Schatten auf den Bildschirm:
»Pfui!« kreischte er in nicht ganz unberechtigtem Zorn.
»Ihr habt ja gelogen!«
»Pappi lügt nie«, belehrte ihn seine Mutter. »Wir wollten nur nachsehen, ob die Ampexlampe nach links gebündelt ist oder nicht. Und jetzt gehen wir schlafen. Gute Nacht.«
So geschah es. Wir schliefen sofort ein.
»Ephraim«, flüsterte nach wenigen Minuten meine Frau aus dem Schlaf, »ich glaube, wir können hinübergehen…«
»Still«, flüsterte ich ebenso schlaftrunken. »Er kommt.« Aus halb geöffneten Augen hatte ich im Dunkeln die Gestalt unseres Sohnes erspäht, der sich – offenbar zu Kontrollzwecken – an unser Zimmer herantastete.
Er nahm mein vorbildlich einsetzendes Schnarchen mit Befriedigung zur Kenntnis und legte sich wieder ins Bettchen, um sich vor dem perfekten Mörder zu fürchten. Zur Sicherheit ließen wir noch ein paar Minuten verstreichen, ehe wir uns abermals auf den Schleichweg zum Fernsehschirm machten.
»Stell den Ton ab«, flüsterte meine Frau. Das war ein vortrefflicher Rat. Beim Fernsehen, und daher der Name, kommt es ja darauf an, was man sieht, nicht darauf, was man hört. Und wenn’s ein Theaterstück ist, kann man den Text mit ein wenig Mühe von den Lippen der Agierenden ablesen. Allerdings muß dann das Bild so scharf wie möglich herauskommen. Zu diesem Zweck drehte meine Frau den entsprechenden Knopf, genauer: den Knopf, von dem sie glaubte, daß es der entsprechende wäre. Er war es nicht. Wir erkannten das daran, daß im nächsten Augenblick der Ton mit erschreckender Vollkraft losbrach.
Und schon kam Amir herbeigestürzt:
»Lügner! Gemeine Lügner! Schlangen! Schlangenlügner!« Und sein Heulen übertönte den Sender Kairo. Da unsere Befehlsgewalt für den heutigen Abend rettungslos untergraben war, blieb Amir nicht nur für die ganze Dauer des dreiaktigen Lustspiels bei uns sitzen, sondern genoß auch noch, leise schluchzend, die Darbietungen zweier Bauchtänzerinnen aus Amman. Am nächsten Tag schlief er im Kindergarten während der Gesangstunde ein. Die Kindergärtnerin empfahl uns telefonisch, ihn sofort in ein Spital zu bringen, denn er sei möglicherweise von einer Tse-Tse-Fliege gebissen worden. Wir begnügten uns jedoch damit, ihn nach Hause zu holen.
»Jetzt gibt’s nur noch eins«, seufzte unterwegs meine Frau.
»Nämlich?«
»Den Apparat verkaufen.«
»Verkauft ihn doch, verkauft ihn doch!« meckerte Amir. Wir verkauften ihn natürlich nicht. Wir stellten ihn nur pünktlich um 8 Uhr abends ab, erledigten die vorschriftsmäßige Prozedur des Zähneputzens und fielen vorschriftsmäßig ins Bett. Unter meinem Kopfkissen lag die auf 21.30 eingestellte Weckuhr. Es klappte. Amir konnte auf seinen zwei Kontrollbesuchen nichts Verdächtiges entdecken, und als der Wecker um 21.30 Uhr sein gedämpftes Klingeln hören ließ, zogen wir leise und behutsam die vorgesehenen Konsequenzen. Der dumpfe Knall, der unsere Behutsamkeit zuschanden machte, rührte daher, daß meine Frau mit dem Kopf an die Türe gestoßen war. Ich half ihr auf die Beine:
»Was ist los?«
»Er hat uns eingesperrt.«
Ein begabtes Kind, das muß man schon sagen; wenn auch auf andrer Linie begabt als Frank Sinatra, dessen Film vor fünf Minuten in Zypern angelaufen war.
»Warte hier, Liebling. Ich versuch’s von außen.«
Durchs offene Fenster sprang ich in den Garten, erkletterte katzenartig den Balkon im ersten Stock, zwängte meine Hand durch das Drahtgitter, öffnete die Türe, stolperte ins Parterre hinunter und befreite meine Frau. Nach knappen zwanzig Minuten saßen wir vor dem Bildschirm. Ohne Ton, aber glücklich. In Amirs Region herrschte vollkommene, fast schon verdächtige Ruhe.
Auf der Mattscheibe sang Frank Sinatra ein lautloses Lied mit griechischen Untertiteln. Und plötzlich…
»Achtung, Ephraim!« konnte meine Frau mir gerade noch zuwispern, während sie das Fernsehgerät ins Dunkel tauchen ließ und mit einem Satz hinter die Couch sprang. Ich meinerseits kroch unter den Tisch, von wo ich Amir, mit einem langen Stock bewehrt, durch den Korridor tappen sah. Vor unserem Schlafzimmer blieb er stehen und guckte, schnüffelnd wie ein Bluthund, durchs Schlüsselloch.
»Hallo!« rief er. »Ihr dort drinnen! Hallo! Schlaft ihr?«
Als keine Antwort kam, machte er kehrt, und zwar in Richtung Fernsehzimmer. Das war das Ende. Ich knipste das Licht an und empfing ihn mit lautem Lachen:
»Hahaha«, lachte ich, und abermals: »Hahaha! Jetzt bist einmal du hereingefallen, Amir, mein Sohn, was?«
Die Details sind unwichtig. Seine Fausthiebe taten mir nicht weh, die Kratzer schon etwas mehr. Richtig unangenehm war, daß man in den Nachbarhäusern alles hörte. Dann holte Amir sein Bettzeug aus dem Kinderzimmer und baute es vor dem Fernsehapparat auf. Irgendwie konnten wir ihn verstehen. Wir hatten ihn tief enttäuscht, wir hatten den Glauben an seine Eltern erschüttert, wir waren die eigentlich Schuldigen. Er nennt uns seither nur »Lügenpappi« und »Schlangenmammi« und zeltet vor dem Bildschirm, bis der Morgen dämmert. In den ersten Nächten sah ich noch ein paarmal nach, ob er ohne uns fernsieht, aber er schlief den Schlaf des halbwegs Gerechten. Wir ließen es dabei. Wir machten erst gar keinen Versuch, ihn zur Übersiedlung in sein Bett zu bewegen. Warum auch? Was tat er denn Übles? Fliegenfangen oder Katzenquälen wäre besser? Wenn er fernsehen will, soll er fernsehen. Morgen verkaufen wir den verdammten Kasten sowieso. Und kaufen einen neuen.
Das Teletaxi
Plötzlich hörte ich einen vertrauten Staccato-Ton, ein kurzes, rhythmisches »tatata-ta-tata«. Es war genau 21 Uhr.
»Was gibt’s im Radio?« fragte ich.
»Keine Ahnung«, lautete die Antwort. »Ich hab das Fernsehen an. Simon Templar.«
Ich beugte mich ein wenig vor und sah ihm über die Schulter. Tatsächlich: zu seinen Füßen lag ein kleiner Fernsehapparat, über den gerade »Der Boß und die 40 Räuber« ihren Einzug hielten, tatata-ta-tata. Bild und Ton kamen verhältnismäßig deutlich, nur manchmal hüpfte der kleine Kasten auf und nieder, denn die Stadtverwaltung von Tel Aviv hatte sich endlich zu den überfälligen Reparaturarbeiten ihrer Hauptverkehrsadern entschlossen.
Als wir die Ben-Jehuda-Straße entlangholperten, streckte der Boß einen intellektuellen Schurken zu Boden und umarmte eine weibliche Gefangene. Aber da nahte in einem Helikopter der dicke Spion.
»Setzen Sie sich schon endlich«, sagte der Fahrer, ohne die Haltung seines Profils zu verändern. »Sie verstellen mir ja die Aussicht auf das Rückfenster.«
Ich ließ mich widerwillig in den Fond fallen:
»Wieso stört Sie das? Sie schauen ja ohnehin die ganze Zeit auf Ihre Füße.«
»Das geht Sie nichts an. Ich kenne meine Fahrbahn, auch ohne sie ständig zu beobachten.«
»Deshalb haben Sie gerade ein rotes Licht überfahren, was?«
»Pst. Sie kommen…«
Meinem neuerlichen Spähversuch begegnete der Wagenlenker auf höchst unfaire Art, indem er den Kasten in einen für mich unzugänglichen Winkel schob. Dabei sehe ich Simon Templar sehr gerne, noch lieber als die Kojak-Serie.
Auf unsicheren Rädern kurvten wir in den Nordau-Boulevard ein. Soviel ich hören konnte, ging auf dem Bildschirm gerade ein wütender Kampf vor sich.
»Setzen!« herrschte das Profil mich an. »Das ist ein Mini-Apparat, nur für den Fahrer.«
Ganz knapp verfehlten wir in diesem Augenblick ein Moped in psychedelischen Farben, aber sichtlich noch ohne Fernsehapparat. Das Profil beugte sich zum Fenster hinaus. Sein Tonfall erreichte die Stärke eines mittleren Nebelhorns im Hafen von Haifa:
»Wo brennt’s denn, du Idiot? Lern zuerst fahren, du Trottel! Willst du uns alle umbringen?«
Während das Kind auf dem Roller – nach kurzer Einschätzung der Körperkräfte seines Widersachers – eilends das Weite suchte, verschaffte ich mir rasch einen Blick auf den Bildschirm: Simon war gerade dabei, dem dicken Kerl, der den Mikrofilm bei sich trug, mit dem Revolver den Schädel zu spalten, mit der anderen Hand hielt er den Agenten der Gegenseite auf Distanz, und alles das in einem ziemlich rasch dahinschlitternden Taxi.
»Ein miserables Gerät«, beschwerte sich das Profil.
»Japanisches Fabrikat, kostet in Amerika 80 Dollar, aber hier verlangen sie 2000 Shekel. Nicht von mir, hehe. Da können sie lange warten. Mein Schwager aus Brooklyn hat’s durch den Zoll geschmuggelt.«
Er schüttelte sich vor Lachen, hielt aber jählings inne, weil Simon soeben dem feindlichen Millionär in die Falle zu gehen drohte.
Und weil das rechte Vorderrad auf den Gehsteig aufgefahren war, von wo es mit hartem Krach wieder die Fahrbahn erreichte. Allmählich verlor ich die Geduld:
»Warum, zum Teufel, fahren Sie nur mit einer Hand?«
»Mit der anderen muß ich den Draht halten, sonst setzt der Empfang aus. Der Mechaniker hat mir gesagt, daß ich eine Art Antenne bin, wenn ich den Draht halte. Er lebt bei meiner Schwester. Schon seit zwei Jahren. Der Mechaniker. Ein feiner Kerl.«
Wir glitten in einer Entfernung von höchstens eineinhalb Millimetern an einem langen, schweren Transportlaster vorbei. Wenn das so weiterging, würde uns Simon noch in einen Unfall verwickeln.
»Das Gesetz«, stieß ich zwischen zwei wilden Sprüngen des Wagens hervor, »das Gesetz verbietet Fernsehapparate in Personenkraftwagen!«
»Das ist eine Lüge. Sie werden in keinem Gesetzbuch eine solche Vorschrift finden. Hingegen ist es streng verboten, mit dem Fahrer zu sprechen.«
»Warten Sie ab, die Polizei wird’s Ihnen schon zeigen!«
»Polizei? Wieso Polizei? Simon muß immer alles allein machen. Die Polizei kommt immer erst dann, wenn man sie nicht mehr braucht. Genau wie bei uns. Und dafür werden sie auch noch dekoriert. Erzählen Sie mir nichts von der Polizei, Herr.«
Der Boß mußte in eine entscheidende Auseinandersetzung geraten sein, denn das Profil starrte unbeweglich zu Boden. Wir fuhren im Zickzack.
»Ein harter Junge, unser Simon. Läßt sich auch von den Weibern nicht drankriegen. Schmust mit ihnen herum, aber von Heiraten keine Rede. Hält sich fit, um die Gangster zu erledigen. Und wie er sie erledigt! Manche Leute sagen, daß er Glück hat. Aber in diesen Dingen kann man kein Glück haben…«
Doch. Manchmal kann man. Zum Beispiel wir, gerade jetzt. Obwohl der Wagen vor uns in rücksichtslos gleichem Tempo dahinfuhr, stießen wir nicht mit ihm zusammen. Seit der Boß dem Bombenräuber in einem gestohlenen Taxi nachjagte, hatte ich das unangenehme Gefühl, daß wir in eine entgegengesetzte Einbahnstraße eingebogen waren. »He -!«
»Setzen!« brüllte das Profil. »Wie oft wollen Sie mir noch die Aussicht blockieren?«
»Sagen Sie mir wenigstens, was auf dem Bildschirm vorgeht.«
»Verrückt geworden? Was soll ich noch alles machen? Fahren – Draht halten – zuschauen – und erzählen?«
»Achtung!!«
Bremsen kreischten. Dicht voreinander, in der allerletzten Sekunde, kamen mit ohrenbetäubendem Krach das Taxi und ein großer, dunkelroter Tanker zum Stillstand. Simon war wie durch ein Wunder unverletzt geblieben. Das Profil fuhr im Rückwärtsgang bis zur Ecke.
»Genug«, sagte ich. »Mir reicht’s. Ich will aussteigen.«
»Acht Shekel siebzig.«
Er nahm das Geld entgegen, ohne mich anzusehen. Geld war ihm gleichgültig. Was ihn interessierte war Simon Templar.
Ich sprang auf die Straße. Es war eine mir völlig unbekannte Gegend.
»Wo bin ich? Das ist doch nicht Ramat Aviv!«
»Sie wollten nach Ramat Aviv? Warum haben Sie das nicht gesagt?«
Und der Fahrer entschwand, ohne mich eines Blicks zu würdigen. Er hielt ihn starr auf seinen japanischen Bildschirm gerichtet. Ein miserables Fabrikat, aber wenn man den Draht in der einen Hand hält, hat man einen leidlich guten Empfang.
Auf Programmsuche
»Guten Tag. Wir kommen im Auftrag des Israelischen Fernsehens und möchten Spielfilme einkaufen.«
»Sie sind am richtigen Ort. Bei uns steht Ihnen eine große Auswahl zur Verfügung: Krimis, Kriegsfilme, Liebesgeschichten, wissenschaftliche Filme, Dokumentationen, Serien und noch vieles andere. Welche Filme bevorzugt das israelische Fernsehpublikum?«
»Nach den Ergebnissen unserer letzten Umfragen vorwiegend Filme zwischen 8 und 9 Uhr abends.«
»Haben wir.«
»Einen Augenblick, meine Herren. Wir müssen Sie darauf aufmerksam machen, daß Israel ein kleines Land und von Feinden umgeben ist. Unser Fernsehbudget ist äußerst beschränkt.«
»Zahlen denn die israelischen Fernseher keine Gebühren?«
»Und ob! Aber das Geld wird in verschiedene Export-Industriezweige investiert. Wieviel, wenn wir fragen dürfen, kosten Ihre Filme?«
»Das hängt vom Herstellungsjahr ab. Nach 1960 produzierte Filme kosten etwa 250 Dollar, zwischen 1950 und 1955 reduziert sich der Preis auf 180 Dollar.«
»Haben Sie etwas aus der Zeit um 1930?«
»Selbstverständlich. Mit Ramon Navarro, Gloria Swanson und der unvergeßlichen Dolores del Rio. Ganz hervorragend. Wir möchten diese Filme mit schweren französischen Rotweinen vergleichen, deren Bouquet durch langes Lagern immer besser wird. Das bezieht sich auch auf Filme wie >Der Satan in der Flaschec. Stammt aus der Zeit der Prohibition. Aufregende Kämpfe zwischen den amerikanischen Behörden und den Alkoholschmugglern. In der Hauptrolle Bela Lugosi als zynisches Monstrum.«
»Kostet?«
»82 Dollar.«
»Haben Sie nicht einen weniger lokalgebundenen Film?«
»Jawohl. Lionel Barrymore in der >Schwarzen Maske< 65 Dollar.«
»Gibt es einen Rabatt für unterentwickelte Länder?«
»Leider nicht. Aber es gibt eine frühere Version des gleichen Films mit Emil Jannings. Aus dem Jahre 1927. Nur 53 Dollar.«
»Könnte man das nicht umkehren?«
»Was umkehren?«
»35 statt 53.«
»Unmöglich. Wir haben für diesen Film weit höhere Angebote von Sammlern. Fragen Sie Ihre Großmütter, meine Herren. Die älteren unter ihnen werden sich gewiß noch erinnern. Und das israelische Publikum mit seinem bekannt exquisiten Geschmack wird an diesem klassischen Werk bestimmt Gefallen finden.«
»Für uns ist das keine Frage der Klassik, sondern des Budgets. Dürfen wir unseren Finanzdirektor in Jerusalem anrufen?«
»Bitte sehr…«
»Hallo, Berditschewski? Wir haben etwas Passendes gefunden. Einen beinahe neuen historischen Film um 53 Dollar. Jawohl, 53. Vielleicht können wir den Preis auf 52 drücken. Nein, die verstehen hier kein Hebräisch. Ich wiederhole: 53 bis 52. Immerhin ein abendfüllender Film mit allem Zubehör, Regisseur, Schauspielern und so weiter… Entschuldigen Sie, meine Herren: unser Finanzdirektor läßt fragen, ob es eine frühere Version der >Schwarzen Maske< gibt?«
»Doch. Herstellungsjahr 1917. Mit Mary Pickford und Douglas Fairbanks. Ein außergewöhnliches Kunstwerk. Heiße Gefühle, wilde Leidenschaften, heftige Gestikulation, lange Frauenröcke.«
»Haben Sie den Film lagernd?«
»Wir schicken jemanden ins Museum und lassen ihn holen. Dauert nicht länger als eine Stunde.«
»Und kostet?«
»1,50 je 500 Meter.«
»Hallo, Berditschewski? Sie haben eine billigere >Maske<, vollkommen schwarz, in bestem Zustand … nein, danach haben wir uns nicht erkundigt … entschuldigen Sie, meine Herren: Herr Berditschewski will wissen, ob es sich um einen Stummfilm handelt?«
»Allerdings. Aber mit sehr klaren Zwischentiteln auf künstlerisch gezeichnetem Hintergrund. Wie geschaffen für den Fernsehschirm. Klavierbegleitung wird auf Tonband beigestellt.«
»Könnten wir vielleicht Harmonikabegleitung haben?«
»Warum nicht? Für das Kaiserliche Äthiopische Fernsehen haben wir unlängst Trommelbegleitung geliefert.«
»Interessant. Aber wir möchten dem klassischen Bildungsinteresse unseres Publikums womöglich noch weiter entgegenkommen. Zum Beispiel mit Rodolfo Valentino.«
»Da hätten wir etwas aus dem Jahre 1903, noch nach der Lumiere-Methode gedreht. 45 Minuten. 20 Dollar.«
»Sagen Sie, bitte, meine Herren – hat es im neunzehnten Jahrhundert schon Filme gegeben?«
»Gewiß. Die sogenannten Bioskop-Rollen. Ein galoppierendes Pferd oder eine tanzende Tänzerin. Durchschnittliche Laufzeit 2 bis 3 Minuten.«
»Komplett?«
»Einschließlich Karbidbeleuchtung und Handkurbel 4 Dollar.«
»Einen Augenblick… Herr Berditschewski fragt, ob Ratenzahlungen möglich sind?«
»Darüber läßt sich reden.«
»Gut. Packen Sie’s ein.«
Minestrone alla televisione
Der Anblick, der sich mir bot, war einigermaßen enttäuschend. Keine Rauferei, nicht einmal eine erregte Diskussion, nichts. Die Gäste saßen schweigend an den Tischen, streng nach einer Richtung angeordnet, und rührten sich nicht.
Ich wandte mich um Auskunft an eine Kellnerin, die ebenso reglos an der Theke lehnte.
»Beirut«, antwortete sie, ohne ihre Blickrichtung zu ändern. »Es hat gerade begonnen.«
Indem ich ihrem Blick folgte, entdeckte ich in der Ecke des Raumes einen Fernsehapparat, auf dessen Bildschirm soeben die Hölle losgebrochen war. Jetzt erst wurde mir inne, daß die streng ausgerichteten Gäste im Saal – und die wild drängende Menschenmasse draußen – der Fernseh-Übertragung eines Wildwestfilmes beiwohnten.
Der Empfang war klar, die hindustanische Synchronisation laut und deutlich, und wer diese Sprache nicht beherrschte, konnte sich an die arabischen Untertitel halten. Was die Handlung betraf, so drehte sie sich um ein fülliges Mädchen, das von einem braven Jungen geliebt wurde, jedoch einen reichen Mann liebte. Oder umgekehrt. Jedenfalls sang sie eine Variation auf das mir völlig unbekannte Lied: »Itschi Kakitschi«, worauf die beiden Rivalen in einen Zweikampf gerieten. Ich verspürte Hunger. Schließlich war ich in einem Restaurant. »Wo kann ich mich hinsetzen?« fragte ich eine Kellnerin, diesmal eine andere, die nicht reglos an der Theke, sondern reglos an der Wand lehnte und das Duell verfolgte. Sie würdigte mich keines Blicks.
»Irgendwohin«, zischte sie. »Und stören Sie nicht.«
Ich sah mich um. Es gab tatsächlich ein paar freie Stühle, aber in der verkehrten Richtung.
»Dort, wo frei ist, sehe ich nichts«, gab ich der Kellnerin zu bedenken. »Können Sie mir nicht helfen?«
»Warten Sie, bis die Reklamesendung kommt.«
Als die Reklamesendung kam, kehrte das Leben ringsum wieder in halbwegs normale Bahnen zurück. Die Kellnerin fand einen Sessel für mich und zwängte ihn zwischen zwei andere, so daß ich mittels eines Schuhlöffels tatsächlich Platz nehmen konnte. Meine Sitznachbarn störte das nicht, denn mittlerweile hatte der Film wieder angefangen. Jetzt liebte das dicke Mädchen einen ganz anderen, der sich daraufhin mit ihren beiden früheren Liebhabern in körperliche Auseinandersetzungen verwickelte. »Entschuldigen Sie bitte.« Ich sprach in Richtung meines Nachbarn linker Hand. »Kann man hier etwas zu essen bestellen?«
»Wer sind Sie?« fragte er zurück, während der arme Liebhaber die größte Mühe hatte, den Nachstellungen seines neuen Rivalen zu entgehen.
»Ich bin ein Gast in diesem Lokal und sitze neben Ihnen. Was gibt es hier zu essen?«
»Sind Sie alt oder jung?«
»Jung.«
»Wie sehen Sie aus?«
»Mittelgroß. Edle, scharfgeschnittene Gesichtszüge. Augengläser. Blond.«
Soeben floh der reiche Liebhaber durch ein plötzlich aufgetauchtes Fenster, verfolgt von einem Lied der Molligen.
»Bestellen Sie Minestrone«, riet mir mein Nachbar. Mehr war aus ihm nicht herauszubringen. Eine Viertelstunde später seufzte er tief auf: »Ich muß gehen. Zu dumm. Der Film dauert sicherlich noch drei Stunden. Zahlen!« Es bedurfte mehrerer in regelmäßigen Intervallen wiederholter Rufe, ehe eine Kellnerin den Weg zu ihm fand, wobei sie sich mit ausgestreckter Hand zwischen Stühlen und Gästen hindurchtastete. Kaum aber hatte sie die Stimmwelle meines Nachbarn angepeilt, als sie mit einer andern Kellnerin zusammenstieß. Niemand kümmerte sich um das Getöse der stürzenden Tassen und der zerbrechenden Teller, denn auf dem Bildschirm bekamen die Leibwächter des reichen Liebhabers gerade den Neuankömmling unter die Fäuste.
»Viereinhalb Shekel.« Die Kellnerin gab meinem Nachbarn das Ergebnis ihrer Kopfrechnung bekannt, worauf er mit bewunderswertem Fingerspitzengefühl die entsprechenden Banknoten aus seinen Taschen hervorholte. Mit einem hastigen »Danke« steckte mir die Kellnerin ein halbes Shekel Wechselgeld in die Hand.
»Ich möchte eine Minestrone«, sagte ich.
»Warten Sie«, sagte die Kellnerin.
Das dicke Mädchen war jetzt im Schloß des reichen Mannes gefangen. Durchs Fenster stieg der dritte Liebhaber ein und sang mit ihr ein Duett. Der nächste Zweikampf konnte nicht mehr lange auf sich warten lassen. »Eine Minestrone, bitte!«
Die Kellnerin tastete mein Gesicht ab, um sich einzuprägen, von wem die Bestellung kam. Dann entfernte sie sich rückwärtsschreitend.
Wenige Minuten später schrie eine Dame in der andern Ecke des Lokals schrill auf, weil die Minestrone, die ihr die Kellnerin in den Busen geschüttet hatte, so heiß war.
»Das ist heute schon das drittemal!« schluchzte sie, wurde aber von ihren Nachbarn heftig zur Ruhe gewiesen. Der arme Liebhaber hatte den reichen an der Gurgel und hielt dem dicken Mädchen die Tür ins Freie frei, nicht ahnend, daß dort ein Dritter auf sie wartete, der sie aber trotzdem nicht bekommen würde, da das Schloß bereits von aufständischer Kavallerie umzingelt war.
Just in diesem Augenblick fühlte ich die Hand der Kellnerin prüfend über mein Gesicht streichen.
»Hier ist Ihre Minestrone, meine Herr«, sagte sie und stellte den Teller auf meine rechte Schulter. Ich roch ganz deutlich, daß es nicht Minestrone war. Mit meinem linken Zeigefinger identifizierte ich den Inhalt des Tellers als gehackte Gansleber. Man sah den Bildschirm zweifellos auch von der Küche aus. Vorsichtig begann ich zu essen. Der Faustkampf der beiden Liebhaber strebte seinem Höhepunkt zu. Der merkwürdig schale Geschmack, den ich im Mund verspürte, kam vom unteren Ende meiner Krawatte, das ich in der Dunkelheit abgeschnitten hatte.
Als die beiden verliebten Faustkämpfer einander in die Arme fielen, weil sie entdeckt hatten, daß sie Blutsbrüder waren, entschloß ich mich zum Verlassen des Lokals, weil ich sonst nie wieder hinauskäme. Begleitet von einem dritten Lied aus molligem Mädchenmund retirierte ich gegen den Ausgang. Ich mußte ihn unbedingt vor Beginn des nächsten Zweikampfes erreichen. Am Ausgang wartete meiner eine angenehme Überraschung: der Kassier lauschte den Klängen des Liedes so hingerissen, daß er keine Zeit für meine Rechnung hatte und mich unwirsch hinausschob.
Tatort
Die Zweiwagenpyramide lockte alsbald eine größere Menschenmenge an, die – wie immer in solchen Fällen – nichts Vernünftiges zu tun wußte. Nur ein junger Mann behielt den Kopf oben und eilte zur nächsten Telefonzelle. Nach einer Minute kam er zurück:
»Ich habe sie verständigt«, berichtete er. »Sie fahren sofort los. Der Kameramann sagt, daß man nichts anrühren soll.«
»Es ist zu spät«, bemerkte ein Zuschauer. »In die Abendnachrichten kommt’s nicht mehr. Bevor sie den Film entwickeln und schneiden und was es da sonst noch zu tun gibt – das schaffen sie nie.«
»Doch, sie schaffen es«, widersprach ein anderer. In aller Augen leuchtete die Fernseh-Gier, in aller Ohren klang schon jetzt die Stimme des Ansagers:
»Unser Reporter befragte an der Unfallstelle einige Augenzeugen.« Vielleicht kommt ein ganzes Team mit drei oder vier Kameras. Vielleicht werden die Aufnahmen für die neue Erziehungsserie des Verkehrsministeriums verwendet: »Die Schrecken der Straße und was man dagegen tun kann.« Dann würden sie mehrmals hintereinander gesendet werden. Dann kommen wir mehrmals hintereinander auf den Bildschirm. Der Pkw-Fahrer oben auf der Pyramide begann zu stöhnen. Das hat uns gerade noch gefehlt: daß er zu Bewußtsein kommt und die Aufnahme schmeißt! Auch auf den Polizisten mit seinem ewigen »Bitte zurücktreten!« könnte man verzichten. Hämische Zurufe schwirrten ihm entgegen:
»He, Lieutenant Kojak… Hältst du dich für die Straßen von San Francisco… Du möchtest wohl allein die ganze Show bestreiten, was …«
Jemand schlug vor, den Pkw noch ein wenig höher zu schieben, damit es richtig sensationell aussähe.
»Lassen Sie nur«, sagte ich. »So, wie er jetzt liegt, ist es gut genug.«
Damit stand für die Menge fest, daß ich ein Mann vom Fernsehen wäre. Einige erinnerten sich, mich in der Sendereihe »So ist das Leben« gesehen zu haben und umringten mich aufgeregt.
»Euer Popsong-Programm ist miserabel«, beschwerte sich einer. »Warum engagiert ihr keine italienischen Sänger? Sie sind die besten.«
Die ältliche Dame, die den Unfall verursacht hatte – ihr selbst war weiter nichts geschehen-, fand es unschön von mir, daß der verbilligte Seniorentarif abgeschafft worden sei. Das hätte ich nicht tun dürfen, meinte sie. Ein Pensionist zupfte mich am Ärmel: Auf seinem Bildschirm erschienen immer wieder diese gewissen Wellenlinien, und ich sollte das endlich reparieren. Im ganzen schien die Ansammlung mit meiner Regie des Vorfalls nicht recht zufrieden zu sein, aber niemand sprach es deutlich aus, weil alle ins Bild kommen wollten.
Der Fahrer oben stöhnte schon wieder. Plötzlich erklang eine freudige Stimme:
»Sie kommen!«
»Keine Spur!« entgegnete die Menge. »Das ist nur die Ambulanz.«
Es war ein schlimmer Augenblick. Was, wenn die Sanitäter den Verletzten abtransportierten? Wo bleiben dann die Aufnahmen?
»Tragen Sie ihn noch nicht weg!« baten die Umstehenden. »Nicht bevor die anderen kommen! Bitte!«
Das Ambulanzteam erkannte die Stichhaltigkeit dieses Ansuchens und übte Zurückhaltung. Nur der Sanitäter, der die Tragbahre bereithielt, warf einen besorgten Blick zu dem eingeklemmten Fahrer hinauf:
»Vielleicht braucht er eine Bluttransfusion oder sonst etwas?«
»Nein, nein«, beruhigte man ihn. »Der nicht. Eben hat er sich wieder bewegt. Und außerdem will er ja ins Bild kommen.«
Ein paar Halbwüchsige kletterten auf Laternenpfähle, um im geeigneten Augenblick in die Kamera grinsen und winken zu können.
»Wasser«, hörte man den Fahrer abermals stöhnen.
»Wasser.«
»Du kriegst einen ganzen Eimer voll!« wurde ihm zugerufen. »Aber jetzt halt still!«
Ein Taxi bog um die Ecke, hielt an und entließ einen schläfrigen Gesellen mit einer Kamera, gefolgt von einem Minderjährigen mit einem Mikrofon. Die Menge verstummte ehrfürchtig. Für die meisten war es das erste Mal, daß sie der Erfindung Fernsehen sozusagen in Fleisch und Blut begegneten. Ein alter Mann murmelte einen Segensspruch.
»Was ist los?« fragte der Kameramann. Die beinahe überfahrene Fußgängerin bezog Posten:
»Er hat mich beinahe überfahren!« rief sie mit schriller Altweiberstimme. »Beinahe überfahren hat er mich!«
Ein Samurai-Typ in einem japanischen Sporthemd stieß sie beiseite:
»Ich hab’s genau gesehen! Diese kleine Wanze kam in rasendem Tempo herangesaust .«
Ringsum ertönten Protestrufe:
»Der Kerl war ja gar nicht dabei … Er ist später gekommen als die Ambulanz … Und jetzt stiehlt er uns die Show… Unerhört…«
Auch ich war angeekelt. Warum haben sie nicht mich gefragt?
»Ich selbst bin ein routinierter Fahrer«, sagte der Samurai gerade in die emsig surrende Kamera. »Fuhr einen Ferrari. Habe an Autorennen teilgenommen. Aber dann hat meine Schwester diesen Verbrecher geheiratet, und da hat mein Vater gesagt: Schluß mit den Autorennen. Na ja, und wie dann die Scheidung kam, war ja vorauszusehen, nicht wahr, da hat’s also bei mir mit dem Training Schwierigkeiten gegeben, man wird ja nicht jünger …«
Inzwischen hatte ich mich an die Kamera herangearbeitet und wäre gut ins Bild gekommen, wenn mich die fast Überfahrene nicht weggezerrt hätte.
»Er hat mich überfahren!« kreischte sie wütend.
»Mich, nicht Sie!«
Die alte Hexe war mir in der Seele zuwider. Jetzt begann sie sogar zu heulen, nur um die Kamera auf sich zu ziehen. Ich, der ich bekanntlich in der Sendung »So ist das Leben« mitgewirkt habe, werde schnöde übergangen, weil sich eine uninteressante Vettel ohne die geringste Kameraerfahrung vordrängt. Man sollte gar nicht glauben, wozu Leute imstande sind, um ins Bild zu kommen.
Kurz entschlossen boxte ich die alte Hexe in die Hüfte, schob mich auf den von ihr usurpierten Platz und deutete auf mich:
»Hallo, Kinder!« stieß ich in großer Hast hervor. »Hier ist Papi! Er war dabei!«
Ein Wißbegieriger nahm die Gelegenheit wahr und richtete ausgerechnet an mich die Frage, ob es sich hier um Video oder um Stereo handelt, der Idiot. Das nützte wiederum der Samurai aus, um die Lebensgeschichte seiner Schwester zu beenden. Kein Wunder, daß der Kameramann es vorzog, die Wagenpyramide zu erklimmen und sein Gerät auf den Fahrer zu richten.
Als der Fahrer das sah, öffnete er die blutleeren Lippen und flüsterte:
»Um Himmels willen … nicht das Profil … bitte von vorne .«
Der Inhaber eines nahegelegenen Ladens drängte sich mit einem Glas Wasser durch die Reihen der Gaffer:
»Ich bringe Wasser für den Verunglückten!« rief er mit breitem Lächeln in die Kamera. »Trinken Sie, alter Junge! Es wird Ihnen guttun!«
Jetzt war der große Augenblick des Verunglückten gekommen:
»Soll ich hinunterkriechen?« fragte er den Kameramann. »Geben Sie mir ein Handzeichen, wenn’s so weit ist!«
Die Sanitäter mit der Tragbahre traten in Aktion. Beim drittenmal klappte es. Die Show war zu Ende. Erwartungsvoll ging ich nach Hause.
Punkt 21 Uhr versammelte sich die Familie um den Fernsehschirm, um Papi in den Abendnachrichten zu sehen. Der Sprecher vertrödelte kostbare Minuten mit allerlei politischem Firlefanz, aber dann war endlich mein Unfall dran. Achtung jetzt -!
»Wo bist du, Papi?« fragte unsere Jüngste. »Man sieht dich ja gar nicht!«
Tatsächlich. Diese Halunken hatten fast den ganzen Samurai im Bild gelassen, dazu etwas Hexe und die Ambulanz. Mich hatten sie geschnitten. Statt dessen trat irgendein offizieller Phrasendrescher vor die Kamera und sprach über Verkehrssicherheit und dergleichen überflüssiges Zeug.
Die können lange warten, bevor ich wieder an einem ihrer Unfälle mitwirke!
Namen auf Endlosschleife
Es sei auch bemerkt, daß die Qualität der Aufnahmen gelegentlich recht unterschiedlich ausfällt. So waren zum Beispiel die Aufnahmen vom Mond um einiges schärfer als die aus dem Parlament. Ebenso macht es nicht das geringste aus, daß unsere Tänzer auf der Mattscheibe immer wie Zwerge a la Toulouse-Lautrec aussehen, daß das Festival von San Remo versehentlich zum viertenmal ausgestrahlt wird. Nicht einmal, daß das Testbild des Senders Stunden vor und nach den Sendungen auf dem Bildschirm flimmert, um den Empfang aller arabischen Sender der Region zu stören, was menschlich zwar verständlich, von der Sache her jedoch ärgerlich ist. Wie gesagt schmälern alle diese Vorkommnisse keineswegs die Freude, die unser junges Fernsehen uns und unserer Nachkommenschaft bereitet. Die einzige ernsthaftere Beschwerde richtet sich gegen den nominellen Bereich, der sich auf unseren Bildschirmen immer breiter macht. Es handelt sich hier um den an und für sich legitimen Wunsch des kleinen Mitarbeiters im zeitgenössischen Fernsehen, seinen Namen in möglichst hoher Frequenz ertönen zu hören, ein chronisch gewordenes Symptom, das die Sendungen zu einem täglichen Namensverzeichnis werden läßt. Wird beispielsweise in den Nachrichten der Filmbericht über einen Zug gezeigt, der aus irgendwelchen Gründen sein Gleis verlassen hat, sagt der Sprecher: »Unser Reporter Dov Mendelevitch war am Ort.« Mit kleiner Verspätung erscheint Dov Mendelevitch mit dem Mikrofon in der Hand, verdeckt den Zug und sagt: »Hier Dov Mendelevitch,« Gleichzeitig erscheinen auf dem Bildschirm Schlag auf Schlag die Buchstaben »Dov Mendelevitch berichtet«, um etwaige Mißverständnisse auszuschließen. Dov Mendelevitch gibt dann zurück in das Studio, wo der Nachrichtensprecher sagt: »Sie sahen die Filmreportage von Dov Mendelevitch«, und wenn im Hintergrund auch noch das Pfeifen der Eisenbahn zu hören war: »Tontechnik: Michael Gutmann-Hirsch. Reiseplanung: Frederike Weiß.«
Die Rundfunk- und Fernsehmitarbeiter mögen mir verzeihen, aber ich habe nie verstanden, weshalb ihre Namen eine solche Bedeutung haben. Wo doch im alltäglichen Leben viele talentierte Menschen ihre Pflicht erfüllen, ohne daß ihre Namen auf Schritt und Tritt erwähnt würden. Sollte demnächst beispielsweise der erste israelische Satellit ins All befördert werden, so werden wir die Namen Hunderter Wissenschaftler, die dies geplant und ausgeführt haben, nie erfahren, nicht einmal den Namen des Verfassers der Nachricht oder des Redakteurs. Der erste, vermutlich auch der einzige Name, den wir erfahren werden, ist der jener Person, der man die Nachricht zum Vorlesen in die Hand gedrückt hat.
Natürlich könnte man behaupten, daß der Verfasser dieser Zeilen Neid verspürt, und es ist auch unwahrscheinlich, daß er frei ist von menschlichen Schwächen. Im Gegenteil, mein innigster Wunsch ist die Einbeziehung in jenen nominellen Bereich. Ich verlange von der Fernsehleitung mit allem Nachdruck die Aufnahme in den Appell als Zuschauer. Die halbe Sendezeit eines jeden Programms ist ohnehin dem Siegeszug der Gestalternamen gewidmet, während hinter den auf- und abflimmernden Buchstaben die Teilnehmer der Sendung die Zeit mit freier Unterhaltung, Kartenspielen oder Gruppengymnastik totschlagen…
Hier ist ein handelsübliches Personenverzeichnis nach einer viertelstündigen Sendung über die Mückenplage:
Idee: Sammy Donner Gestaltung: Immanuel M. Kasten Bearbeitung: Henry Weinreb Redaktion: Danni Strahl Regie: Arje Lichtmann Regieassistenz: Mirjam Schwartz-Bonaparte Ton: Wolf Schweigsam Mücken: Mussa Dingdas Schnitt: Baruch Lob Produktion: Itamar Goldfinger Abwesend: Pinchas Zitrin Überwachung: Rabbiner Moshe Gassman Zuschauer: Ephraim Kishon Erinnern Sie sich noch an vergangenen Dienstag? Da verschwand plötzlich das Bild, und es waren nur noch tanzende Linien in Zickzack und Meander zu sehen. Seltsamerweise zeichnete dafür kein Mensch verantwortlich. Warum kann man nicht eine Schrift einblenden: »Für Bildstörungen zuständig: Menasche Treuherz jr.«?
Werfen wir nun einen Blick auf das armselige Opfer des Fernsehens, das einsam und allein ohne jedes Publikum vor sich hinvegetieren muß – auf das Kino. Während einer Fußballweltmeisterschaft lassen sich in den riesigen Kinosälen die Zuschauer an den Fingern einer Hand abzählen, meistens am kleinen. Kein Wunder also, daß die Moguln der Filmindustrie sich um diesen kleinen Finger hinter den Kulissen der Filmstudios einen monströsen Kampf liefern. Schon in den grauen Anfangszeiten der Kinematographie galt dieser Erwerbszweig als einer, in dem das Gesetz des Dschungels herrschte. Aber heute, wo wir an der Schwelle zum Zeitalter des alles verzehrenden Kabelfernsehens stehen, wage ich die Behauptung, daß der Dschungel im Vergleich zur Filmwirtschaft ruhig, übersichtlich und recht friedlich ist.
Fernsehen der dritten Art
Vor der Tür standen die Großmanns. Dov und Lucy Großmann, ein nettes Ehepaar mittleren Alters und in Pantoffeln. Da wir einander noch nie direkt begegnet waren, stellten sie sich vor und entschuldigten sich für die Störung zu so später Stunde.
»Wir sind ja Nachbarn«, sagten sie. »Dürfen wir für einen Augenblick eintreten?«
»Bitte sehr.«
Mit erstaunlicher Zielsicherheit steuerten die Großmanns in den Salon, umkreisten den Flügel und hielten vor dem Teewagen inne.
»Siehst du?« wandte sich Lucy triumphierend an ihren Gatten. »Es ist keine Nähmaschine.«
»Ja, ja, schon gut.« Dovs Gesicht rötete sich vor Ärger.
»Du hast gewonnen. Aber vorgestern war ich im Recht. Sie haben keine Encyclopaedia Britannica.«
»Von Britannica war nie die Rede«, korrigierte ihn Lucy. »Ich sagte nichts weiter, als daß sie eine Enzyklopädie im Haus haben und überhaupt sehr versnobt sind.«
»Schade, daß wir deine geschätzten Äußerungen nicht auf Tonband aufgenommen haben.«
»Ja, wirklich schade.«
Es blieb mir nicht verborgen, daß sich in dieses Gespräch eine gewisse Feindseligkeit einzuschleichen drohte. Deshalb schlug ich vor, daß wir alle zusammen Platz nehmen und uns aussprechen sollten, wie es sich für erwachsene Menschen geziemt. Die Großmanns nickten – jeder für sich – zustimmend, Dov entledigte sich seines Regenmantels, und beide setzten sich hin. Dovs Pyjama war graublau gestreift.
»Wir wohnen im Haus gegenüber«, begann Dov und zeigte auf das Haus gegenüber. »Im fünften Stock. Voriges Jahr haben wir eine Reise nach Hongkong gemacht und haben uns dort einen hervorragenden Feldstecher gekauft.«
Ich bestätigte, daß die japanischen Erzeugnisse tatsächlich von höchster Qualität wären.
»Maximale Vergrößerung eins zu zwanzig«, prahlte Lucy und zupfte an ihren Lockenwicklern. »Mit diesem Glas sehen wir jede Kleinigkeit in Ihrer Wohnung. Und Dobby, der sich manchmal gern wie ein störrisches Maultier benimmt, hat gestern steif und fest behauptet, daß der dunkle Gegenstand hinter Ihrem Flügel eine Nähmaschine ist. Er war nicht davon abzubringen, obwohl man auf diesem Gegenstand ganz deutlich eine Blumenvase stehen sah. Seit wann stehen Blumenvasen auf Nähmaschinen? Eben. Aber Dobby wollte das nicht einsehen. Auch heute noch haben wir den ganzen Tag darüber gestritten. Schließlich sagte ich zu Dobby: >Weißt du was? Wir gehen zu denen hinüber, um nachzuschauen, wer recht hat.< Und hier sind wir.«
»Sie haben richtig gehandelt«, lobte ich. »Sonst hätte der Streit ja nie ein Ende genommen. Noch etwas?«
»Nur die Vorhänge«, seufzte Dov.
»Was ist’s mit den Vorhängen und warum seufzen Sie?« fragte ich.
»Weil, wenn Sie die Vorhänge vor Ihrem Schlafzimmer zuziehen, können wir gerade noch Ihre Füße sehen.«
»Das ist allerdings bitter.«
»Nicht daß ich mich beklagen wollte!« lenkte Dov ein.
»Sie brauchen auf uns keine Rücksicht zu nehmen. Es ist ja Ihr Haus.«
Die Atmosphäre wurde zusehends herzlicher. Meine Frau servierte Tee und Salzgebäck. Dov fingerte am Unterteil seiner Armlehne: »Was mich kolossal interessieren würde…«
»Ja? Was?«
»Ob hier noch der Kaugummi pickt. Er war rot, wenn ich nicht irre.«
»Blödsinn«, widersprach Lucy. »Er war gelb.«
»Rot!«
Die Feindseligkeiten flammten wieder auf. Können denn zwei zivilisierte Menschen keine fünf Minuten miteinander sprechen, ohne zu streiten? Als ob es auf solche Lappalien ankäme! Zufällig war der Kaugummi grün, ich wußte es ganz genau.
»Einer Ihrer Nachtmahlgäste hat ihn vorige Woche hingeklebt«, erläuterte Dov. »Ein hochgewachsener, gutgekleideter Mann. Während Ihre Frau in die Küche ging, nahm er den Kaugummi aus dem Mund, blickte sich um, ob ihn jemand beobachtete, und dann – wie gesagt.«
»Köstlich«, kicherte meine Frau. »Was Sie alles sehen!«
»Da wir kein Fernsehgerät besitzen, müssen wir uns auf andere Weise Unterhaltung verschaffen. Sie haben doch nichts dagegen?«
»Keine Spur.«
»Aber Sie sollten besser auf den Fensterputzer aufpassen, der einmal in der Woche zu Ihnen kommt. Auf den im grauen Arbeitskittel. Er geht dann immer in Ihr Badezimmer und benützt Ihr Deodorant.«
»Wirklich? Sie können sogar in unser Badezimmer sehen?«
»Nicht sehr gut. Wir sehen höchstens, wer unter der Dusche steht.«
Die nächste Warnung bezog sich auf unseren Babysitter.
»Sobald Ihr Kleiner einschläft«, eröffnete uns Lucy, »zieht sich das Mädchen in Ihr Schlafzimmer zurück. Mit ihrem Liebhaber. Einem Studenten. Mit randloser Brille.«
»Wie ist denn die Aussicht ins Schlafzimmer?«
»Nicht schlecht. Nur die Vorhänge stören, das sagte ich Ihnen ja schon. Außerdem mißfällt mir das Blumenmuster.«
»Ist wenigstens die Beleuchtung ausreichend?«
»Wenn ich die Wahrheit sagen soll: nein. Manchmal sind überhaupt nur schattenhafte Konturen zu sehen. Fotografieren kann man so etwas nicht.«
»Die Beleuchtungskörper in unserem Schlafzimmer«, entschuldigte ich mich, »sind eigentlich mehr fürs Lesen gedacht. Wir lesen sehr viel im Bett, meine Frau und ich.«
»Ich weiß, ich weiß. Aber manchmal kann einen das schon ärgern, glauben Sie mir.«
»Dov!« warf Lucy vorwurfsvoll dazwischen. »Mußt du denn auf die Leute immer gleich losgehen?«
Und wie zum Trost gab sie uns bekannt, was sie am liebsten sah: Wenn meine Frau zum Gutenachtsagen ins Kinderzimmer ging und unser Allerjüngstes auf den Popo küßte.
»Es ist eine wirkliche Freude, das mitanzusehen!« Lucys Stimme klang ganz begeistert. »Vorigen Sonntag hatten wir ein kanadisches Ehepaar zu Besuch, beide sind Innenarchitekten, und beide erklärten unabhängig voneinander, daß ihnen ein so rührender Anblick noch nie untergekommen sei. Sie versprachen, uns ein richtiges Teleskop zu schicken, eins zu vierzig, das neueste Modell. Übrigens hat Dov schon daran gedacht, an Ihrem Schlafzimmer eines dieser japanischen Mikrofone anzubringen, die angeblich bis auf zwei Kilometer Entfernung funktionieren. Aber ich möchte lieber warten, bis wir uns etwas wirklich Erstklassiges leisten können, aus Amerika.«
»Wie recht Sie doch haben. Bei solchen Sachen soll man nicht sparen.«
Dobby stand auf und säuberte seinen Pyjama von den Bröseln der belegten Brötchen, mit denen meine Frau ihn mittlerweile bewirtet hatte.
»Wir freuen uns wirklich, daß wir Sie endlich von Angesicht zu Angesicht kennengelernt haben« sagte er herzlich. Hierauf versetzte er mir einen scherzhaften Rippenstoß und flüsterte mir zu: »Achten Sie auf Ihr Gewicht, alter Knabe! Man sieht Ihren Bauch bis ins gegenüberliegende Haus.«
»Ich danke Ihnen, daß Sie mich darauf aufmerksam machen«, erwiderte ich ein wenig beschämt.
»Nichts zu danken. Wenn man einem Nachbarn helfen kann, dann soll man es tun, finden Sie nicht auch?«
»Natürlich.«
»Und finden Sie nicht, daß das Blumenmuster auf Ihren Vorhängen – «
»Sie haben vollkommen recht.«
Wir baten die Großmanns, recht bald wiederzukommen. Ein wenig später sahen wir im fünften Stock des gegenüberliegendes Hauses das Licht angehen. Im Fensterrahmen wurde Dobbys schlanke Gestalt sichtbar. Als er den Feldstecher aus Hongkong ansetzte, winkten wir ihm. Er winkte zurück. Kein Zweifel: wir hatten neue Freunde gewonnen.
A Star is born
Ferner entsinne ich mich, während einer meiner Sommerurlaube den Kilimandscharo bezwungen zu haben, und wenn der Reuter-Korrespondent damals nicht die Grippe bekommen hätte, wäre ich bestimmt in den Rundfunknachrichten erwähnt worden. Ein paar Jahre später komponierte ich Beethovens 10. Symphonie und bekam eine nicht ungünstige Kritik in der »Bastel-Ecke« einer jiddischen Wochenzeitung. Ein anderer Höhepunkt meines Lebens ergab sich, als ich ein Heilmittel gegen den Krebs entdeckte und daraufhin vom Gesundheitsminister empfangen wurde; er unterhielt sich mit mir volle sieben Minuten, bis zum Eintreffen der Delegation aus Uruguay. Sonst noch etwas? Richtig, nach Erscheinen meiner »Kurzgefaßten Geschichte des jüdischen Volkes von Abraham bis heute« wurde ich vom Nachtstudio des Staatlichen Rundfunks interviewt. Aber für den Mann auf der Straße blieb ich ein Niemand. Und dann, wie gesagt, kam die große Wende.
Sie kam aus blauem Himmel und auf offener Straße.
Ein Kind trat auf mich zu, hielt mir ein Mikrofon vor den Mund und fragte mich nach meiner Meinung über die Lage. Ich antwortete:
»Kein Anlaß zur Besorgnis.«
Dann ging ich nach Hause und dachte nicht weiter daran. Als ich mit der besten Ehefrau von allen beim Abendessen saß, ertönte plötzlich aus dem Nebenzimmer – wo unsere Kinder vor dem Fernsehschirm hockten und sich auf dem Fußboden verköstigten – ein markerschütternder Schrei. Gleich darauf erschien der Knabe Amir in der Tür, zitternd vor Aufregung.
»Papi!« stieß er hervor. »Im Fernsehen… Papi… du warst im Fernsehen…!«
Er begann unartikuliert zu jauchzen, erlitt einen Hustenanfall und brachte kein Wort hervor. Der Arzt, den wir sofort herbeiriefen, wartete gar nicht erst, bis er ins Zimmer trat. Schon auf der Stiege brüllte er:
»Ich hab Sie gesehen! Ich hab Sie gehört, was Sie im Fernsehen gesagt haben! Kein Anlaß zur Besorgnis!«
Jetzt erinnerte ich mich, daß neben dem Mikrofonkind noch ein anderes mit einem andern Gegenstand in der Hand postiert gewesen war und daß irgend etwas leise gesurrt hatte, während ich mich zur Lage äußerte. In diesem Augenblick ging das Telefon.
»Ich danke Ihnen«, sagte eine zittrige Frauenstimme.
»Ich lebe seit sechzig Jahren in Jerusalem und danke Ihnen im Namen der Menschheit.«
Die ersten Blumen trafen ein. Der Sprecher des Parlaments hatte ihnen ein Kärtchen beigelegt: »Ihr unverzagter Optimismus bewegt mich tief. Ich wünsche Ihren Unternehmungen viel Erfolg und bitte um zwei Fotos mit Ihrem Namenszug.«
Immer mehr Nachbarn kamen, stellten sich längs der Wände auf und betrachteten mich ehrfurchtsvoll. Ein paar Wagemutige traten näher an mich heran, berührten den Saum meines Gewandes und wandten sich rasch ab, um ihrer Gefühlsaufwallung Herr zu werden. Es waren glorreiche Tage, es war eine wunderbare Zeit, es war die Erfüllung lang verschollener Jugendträume. Auf der Straße blieben die Menschen stehen und raunten hinter meinem Rücken:
»Da geht er … Ja, das ist er … Kein Anlaß zur Besorgnis ... Er hat es im Fernsehen gesagt…«
Die Verkäuferin eines Zigarettenladens riß bei meinem Eintritt den Mund auf, japste nach Luft und fiel in Ohnmacht. Damen meiner Bekanntschaft, die mich bisher nie beachtet hatten, warfen mir verräterisch funkelnde Blicke zu. Und Blumen, Blumen, Blumen .
Auch im Verhalten der besten Ehefrau von allen änderte sich etwas, und zwar zu meinen Gunsten. Eines Nachts erwachte ich mit dem unbestimmten Gefühl, daß mich jemand ansah. Es war meine Ehefrau. Das Mondlicht flutete durchs Zimmer, sie hatte sich auf den Ellbogen gestützt und sah mich an, als sähe sie mich zum erstenmal im Leben.
»Ephraim«, säuselte sie. »Im Profil erinnerst du mich an Prince.«
Sogar an mir selbst nahm ich Veränderungen wahr. Mein Schritt wurde elastischer, mein Körper spannte sich, meine Mutter behauptete, ich wäre um mindestens drei Zentimeter gewachsen. Wenn ich an einem Gespräch teilnahm, begann ich meistens mit den Worten: »Gestatten Sie einem Menschen, der sich auch schon im Fernsehen geäußert hat, seine Meinung zu sagen …«
Nach all den Fehlschlägen der vergangenen Jahre, nach all den vergeblichen Bemühungen, mit Enzyklopädien und Symphonien und derlei läppischem Zeug etwas zu erreichen, schmeckte ich endlich das süße Labsal des Ruhms. Nach konservativen Schätzungen hatten mich am Dienstag sämtliche Einwohner des Landes auf dem Bildschirm gesehen, mit Ausnahme eines gewissen Jehuda Grünspan, der sich damit entschuldigte, daß gerade bei meinem Auftritt eine Röhre seines Apparats zu Bruch gegangen sei. Aus purer Gefälligkeit habe ich das Interview für ihn brieflich rekonstruiert.
Aller Voraussicht nach wird unsere Straße in »Interview-Straße« umbenannt werden, vielleicht auch in »Boulevard des kleinen Anlasses«. Ich habe jedenfalls neue Visitenkarten in Auftrag gegeben:
|
|
Manchmal, an langen Abenden, fächere ich diese Karten vor mir auf und betrachte sie. Etwas Tröstliches geht von ihnen aus, und ich kann Trost gebrauchen. Die undankbare Menge beginnt mich zu vergessen. Immer öfter geschieht es, daß Leute auf der Straße glatt an mir vorbeisehen oder durch mich hindurch, als ob ich ein ganz gewöhnlicher Mensch wäre, der noch nie im Fernsehen aufgetreten ist. Ich habe in Jerusalem nachgefragt, ob eine Wiederholung der Sendung geplant ist, um das Erinnerungsvermögen des Publikums ein wenig aufzufrischen. Die Antwort war negativ.
Ich treibe mich auf der Straße herum und halte Ausschau nach Kindern mit Mikrofonen oder surrenden Gegenständen in der Hand. Entweder sind keine da, oder sie fragen mich nicht. Unlängst saß ich in der Oper. Kurz vor dem Aufgehen des Vorhangs kam ein Kameraträger direkt auf mich zu – und richtete im letzten Augenblick den Apparat auf meinen Nebenmann, der in der Nase bohrte. Auch ich begann zu bohren, aber es half nichts.
Vor ein paar Tagen benachrichtigte man mich, daß ich für meine jüngste Novelle den Bialik-Preis gewonnen hätte. Ich eilte in die Sendezentrale und erkundigte mich, ob das Fernsehen zur Preisverteilung käme. Da man mir keine Garantie geben konnte, sagte ich meine Teilnahme ab. Beim Verlassen des Gebäudes hat mir eine Raumpflegerin der Aufnahmehalle B versprochen, mich unter die Komparsen der Sendereihe »Mensch ärgere dich nicht!« einzuschmuggeln. Ich fasse neuen Mut.
GESCHICHTEN VON DER DRITTEN SCHRAUBE
Zwei Schrauben im Dreiviertelakt
In Israel gibt es eine Produktionshemmung, die sich – rein technologisch – wie folgt formulieren ließe:
»Der israelische Handwerker ist physisch und geistig außerstande, auf dem lokalen Produktionssektor, etwa im Baugewerbe, jene Anzahl von Schrauben anzubringen, die mit der Anzahl der Löcher übereinstimmt, welche zur Anbringung von Schrauben vorgesehen sind.«
Mit anderen, weniger anspruchsvollen Worten: Seit Bestehen des Staates Israel hat noch kein israelischer Handwerker jemals die jeweils vorgeschriebene Anzahl von Schrauben eingeschraubt. Sondern statt dreier Schrauben nimmt er zwei oder vielleicht nur eine. Warum?
Internationale Fachleute erblicken die Ursache dieses Verhaltens in einem übersteigerten Selbstbewußtsein des organisierten israelischen Arbeiters, der davon durchdrungen ist, daß zwei jüdische Schrauben so gut sind wie drei nichtjüdische. Die Tiefseelenforscher, besonders die Anhänger Jungs und seiner Archetypen-Theorie, führen das Zwei-Schrauben-Mysterium auf den »Ewigen Juden« zurück, das heißt auf die tiefe Skepsis unserer stets verfolgten, immer wieder zur Wanderschaft gezwungenen Vorväter, die nicht an die Dauerhaftigkeit materieller Güter glauben konnten. Sei dem wie immer – die fehlende Schraube ist meistens die mittlere. Das Muster sieht ungefähr so aus:
•o•
Es tritt am häufigsten bei hebräischen Türangeln auf, und zwar sowohl bei Zimmer- wie bei Schranktüren. Man kann ihm eine gewisse Symmetrie und dekorative Balance nicht absprechen. Demgegenüber zeugt seine rechte Abweichung entschieden von seelischer Unausgeglichenheit:
• • o
Dieses Arrangement erfreut sich unter Radioapparaten, Plattenspielern und an der Wand zu befestigenden Küchengerätschaften größter Verbreitung. Eine dritte Form wird geradezu kultisch von der jungen israelischen Kraftwagenindustrie gepflegt, und zwar an den mit freiem Auge nicht sichtbaren Bestandteilen des Motors, wo ihre Anwendung nur dem geübten Ohr durch das rhythmische Klappern freigewordener Metallplatten erkennbar wird, meistens auf einsamen Landstraßen. Man bezeichnet diese Form als
»Mono-Schraubismus«:
o o•
Gründliche, mit staatlicher Unterstützung durchgeführte Nachforschungen haben keinen einzigen Fall von drei Schraubenlöchern ergeben, die mit allen drei dazugehörigen Schrauben ausgestattet gewesen wären. Vor kurzem wurde in einer Waffenfabrik im oberen Galiläa ein feindlicher Spion entdeckt, der sich dadurch verraten hatte, daß er alle Schraubenlöcher mit Schrauben versah.
Ich für meine Person habe in einer Tischlerei in Jaffa ein aufschlußreiches Experiment durchgeführt. Ich beobachtete den Besitzer, einen gewissen Kadmon, bei der Herstellung eines von mir bestellten Hängeregals und bei der Anbringung zweier Schrauben an Stelle der vorgesehenen drei.
»Warum nehmen Sie keine dritte Schraube?« fragte ich.
»Weil das überflüssig ist«, antwortete Kadmon. »Zwei tun’s auch.«
»Wozu sind dann drei Schraubenlöcher da?«
»Wollen Sie ein Regal haben, oder wollen Sie mit mir plaudern?« fragte Kadmon zurück. Unter der Einwirkung meiner Überredungskünste erklärte er sich schließlich bereit, eine dritte Schraube zu nehmen, und machte sich fluchend an die Arbeit. Irgendwie mußte sich die Kunde davon verbreitet haben, denn aus der Nachbarschaft strömten alsbald viele Leute (darunter auch einige Tischler) herbei, um dem einmaligen Schauspiel beizuwohnen. Sie alle gaben der Meinung Ausdruck, daß bei mir eine Schraube locker sei.
Der Blaumilch-Kanal
Nach seinem vom Verlust des Schuhlöffels ausgelösten Tobsuchtsanfall beruhigte sich Blaumilch allmählich, wartete das Dunkel der Nacht ab, öffnete seine Zellentür und entwich. Er erreichte noch ganz knapp den Autobus nach Tel Aviv und begab sich dortselbst schnurstracks zum Solel-Boneh-Warenhaus, in das er unbemerkt hineinschlüpfte. Das geschah am Mittwoch.
Donnerstag kam der Verkehr an der Kreuzung Allenby Road und Rothschildboulevard in aller Frühe zum Stillstand. Noch im Morgendämmer war in der Mitte der Straße ein Zelt errichtet worden, und vier verrostete, in weitem Quadrat aufgestellte Öltrommeln zeigten an, daß Straßenarbeiten im Gang waren. Um 6 Uhr erschien ein Straßenarbeiter mittleren Alters, der einen fabrikneuen pneumatischen Drillbohrer hinter sich herschleppte. Um 6.30 Uhr zog er mit diesem Bohrer zwei fußtiefe, einander überschneidende Gräben durch das Pflaster, und zwar dergestalt, daß sie die vier Ecken der Straßenkreuzung durch ein »X« miteinander verbanden. Um 7 Uhr ging er zum Frühstück. Um 10 Uhr war das Chaos nicht mehr zu überbieten.
Die Ketten der wild hupenden Autos reichten bis in die Außenbezirke Tel Avivs. Berittene Polizisten, nach allen Seiten Befehle brüllend, sprengten umher, aber auch sie wurden vom höllisch siedenden Durcheinander verschlungen.
Zu Mittag erschien der Polizeimeister, beauftragte die zweiundzwanzig höchstrangigen unter den anwesenden Polizeioffizieren, um jeden Preis die Ordnung wiederherzustellen, und machte sich zornbebend auf den Weg zum Rathaus – selbstverständlich zu Fuß, denn es verkehrten längst keine Autobusse mehr. Alle verfügbaren Ambulanzen und Löschwagen der städtischen Feuerwehr wurden zum Einsatz beordert und versuchten gemeinsam einen Durchbruch. Der Versuch scheiterte.
Ein einziger behielt in diesem ganzen unbeschreiblichen Durcheinander den Kopf oben: der Mann, der die Straßenarbeiten durchführte. »Tatatata« machte der Drillbohrer in Kasimir Blaumilchs starken Händen, während er sich langsam, aber sicher die Allenby Road entlanggrub, in der Richtung zum Meer. Der Polizeiminister traf den Leiter der städtischen Straßenbauabteilung, Dr. Kwibischew, nicht in seinen Amtsräumen an. Dr. Kwibischew war nach Jerusalem gefahren, und sein Vertreter zeigte sich nur mangelhaft informiert. Er versprach jedoch dem Minister, die Straßenarbeiten sofort nach Rückkehr Dr. Kwibischews einstellen zu lassen, und telegrafierte in diesem Sinn nach Jerusalem.
Auch der Bürgermeister hatte Wind von der Sache bekommen und entsandte seinen Sekretär zu sofortigen Nachforschungen an Ort und Stelle. Der Sekretär passierte anstandslos den dreifachen Polizeikordon, trat an den drillbohrenden Arbeiter heran und nützte eine kurze Pause im nervenzermürbenden »Tatatata« zu der Frage aus, wann ungefähr mit der Beendigung der Arbeit zu rechnen sei.
Kasimir Blaumilch gab zuerst keine Antwort. Als er sah, daß er den lästigen Fragesteller auf diese Art nicht loswurde, warf er ihm das einzige hebräische Wort hin, das er kannte:
»Chammor! Esel!«
Gegen Abend gelang es der Polizei, mit übermenschlicher Anstrengung und stellenweise unter Verwendung von Tränengasbomben eine Art Ordnung in das Chaos zu bringen, ihre berittenen Kollegen und deren Pferde im Zustand völliger Erschöpfung zu bergen und den gesamten Verkehr im Umkreis von zwei Kilometern zu sperren. Das Rathaus und die Direktion des Solel-Boneh-Konzerns wurden hiervon verständigt.
Zwei Tage später, sofort nach Erhalt des Telegramms, kehrte Dr. Kwibischew aus Jerusalem zurück und fand seine Amtsräume völlig auf den Kopf gestellt: Die Beamtenschaft hatte in den Archiven nach dem Straßenreparaturprojekt »Allenby-Rothschild« geforscht, hatte zwei verschiedene Pläne gefunden und wußte nicht, welcher der richtige war. Dr. Kwibischew ließ sich die Pläne vorlegen, fand in beiden verschiedentliche Mängel des Kloakenwesens erwähnt und leitete die Pläne an die Kanalisationsabteilung weiter, deren Chef sich gerade auf einer wichtigen Mission in Haifa befand. Die Pläne wurden ihm durch einen Sonderkurier nachgeschickt, kamen jedoch unverzüglich mit dem Vermerk zurück, daß es sich hier um einen Irrtum handeln müsse, da Tel Aviv kein nennenswertes Kanalisationssystem besitze. Nach Dr. Kwibischews Strafversetzung ins Handelsministerium machte sich sein Nachfolger, Chaim Pfeiffenstein, an ein gründliches Studium des ganzen Dossiers, versah es mit einem großen roten Fragezeichen, schickte es ans Arbeitsministerium und wollte wissen, seit wann es üblich sei, daß das Ministerium öffentliche Arbeitsprojekte in Angriff nehme, ohne vorher die Stadtverwaltung zu konsultieren. Inzwischen hatte sich Kasimir Blaumilch bis zur Rambamstraße durchgegraben, vom unablässigen »Tatatata« seines Drillbohrers und von seinen vier rostigen Öltrommeln getreulich begleitet. Fassungslos sahen die Bewohner der Allenby Road diese einstmals so wichtige Verkehrsader in einen von Makadamschotter übersäten Wüstenpfad verwandelt, auf dem sich selbst die Fußgänger nur mit Mühe fortbewegen konnten (Fahrzeuge überhaupt nicht).
Aber die eigentliche Verkehrskatastrophe trat erst allmählich zutage. Infolge des Wegfalls von Allenby Road und Rothschildboulevard waren die Seitenstraßen einer Überlastung ausgesetzt, der sich nur durch sofortige Verbreiterung beikommen ließ. Die Regierung legte eine Anleihe auf, um die erforderlichen Geldmittel flüssig zu machen. Und da sich die Verlegung der Autobusremise nach Norden als unaufschiebbar erwies, mußte die Wohnsiedlung »Rabbi Schmuck« in aller Eile geschleift werden.
Chaim Pfeiffenstein, dessen Anfrage vom Arbeitsministerium scharf zurückgewiesen worden war, erstattete dem Bürgermeister Bericht und verlangte sodann von Solei Boneh genaue Auskünfte über das Fortschreiten des Unternehmens. Pjotr Amal, Solei Bonehs Generalmanager für Straßenbauprojekte, ließ keinen Zweifel, daß er der Angelegenheit seine volle Aufmerksamkeit zuwenden würde. Eine Abschrift der gesamten Korrespondenz ging an die Umsiedlungszentrale der Jewish Agency.
Der Vorschlag Pjotr Amals, zwischen Tel Aviv und dem Arbeitsministerium zu vermitteln, fand zwar die Billigung der Histadruthexekutive, wurde aber vom Bürgermeister im Einvernehmen mit den Autobusgewerkschaften abgelehnt, da zuerst die Straßenarbeiten eingestellt werden müßten.
Allenby Road war um diese Zeit nicht mehr zu erkennen: zwischen Beton- und Makadamwällen zog sich ein tiefer Graben, von Wolken feinen Staubes überlagert. Aus geborstenen Wasserleitungen schossen gelegentlich hohe Springfontänen empor. Die Wohnhäuser standen leer.
Jetzt, auf dem Höhepunkt der Krise, zeigte sich der politische Weitblick Pjotr Amals. Er lud Chaim Pfeiffenstein zu einer Konferenz, und nach mehrstündigen, erregten Debatten einigte man sich dahin, daß die Straßenarbeiten so lange suspendiert bleiben sollten, bis eine parlamentarische Kommission den Sachverhalt untersucht hätte. Das Kabinett und die Präsidentschaftskanzlei erhielten je ein Memorandum über diese Vereinbarung.
Sie war bereits überflüssig geworden. Wenige Tage zuvor hatte Kasimir Blaumilch seine Bohrarbeiten durch eine geniale Linkswendung abgekürzt und erreichte noch am selben Abend die offene See. Was weiter geschah, ist nicht mehr aufregend: das Meerwasser ergoß sich in den vormals als »Allenby Road« bekannten Kanal, und alsbald schäumte es auch an die Ufer des Rothschildboulevards.
Es dauerte nicht lange, bis die Stadt der neuen Möglichkeiten gewahr wurde, die sich da boten, bis die ersten Wassertaxis auftauchten und die ersten Privatmotorboote sich ihnen zugesellten. Neues, pulsierendes Leben griff allenthalben um sich. Die offizielle Inbetriebnahme der Wasserwege erfolgte in feierlicher Weise durch den Bürgermeister, der dem Solei Boneh für die planmäßige Vollendung des gewaltigen Projektes in bewegten Worten dankte und abschließend bekanntgab, daß Tel Aviv fortan den Beinamen »Das Venedig des Mittleren Ostens« führen würde.
»A« wie Aufzug
Was mich betrifft, so habe ich das Steigen in jeder beliebigen Form schon längst aufgegeben. Die einfache Begründung dafür ist in der Tatsache zu finden, daß ich schon nach der ersten Stufe müde werde. Das Ergebnis meines langen Meditierens und der intensiven Betrachtung meines Federhalters liegt auf der Hand: Es gibt keinen verläßlicheren Gradmesser für das Altern als die Stufen einer Treppe. In meiner Jugendzeit, ich erinnere mich nur ungern daran, erstürmte ich eine Treppe, indem ich drei Stufen auf einmal nahm, und pflegte ohne Atemnot das achte Stockwerk zu erreichen. Zur Zeit meiner männlichen Reife konnte ich immer noch alles bewältigen, was unterhalb des vierten Stockwerks stattfand. Heutzutage, in meinen sogenannten besten Jahren, ermüdet mich schon die erste Stufe.
So preise ich nunmehr die Amerikaner, die der Menschheit den Lift gegeben haben. Auch wenn sie selbst diesen Lift Elevator nennen, um die Engländer zu ärgern.
Zum Zeitpunkt, als die Fahrstühle erfunden wurden – das war 1853, soweit ich mich erinnere –, wurden die Apparate von importierten Sklaven in die Höhe gezogen. Der Fortschritt brachte es mit sich, daß man seit Jahren schon auf Sklaven verzichtet und sich des elektrischen Stroms bedient.
Die Folge ist, daß Fahrstühle von Zeit zu Zeit beschließen, außer Betrieb zu sein. Bei solchen Gelegenheiten läßt sich wieder einmal die Überlegenheit der Sklavenarbeit gegenüber der modernen Technik feststellen. Bei Stromausfall pflegen nämlich diese Dinger steckenzubleiben. Dann ist man genötigt, irgendeinen Handwerker herbeizurufen, der gerade unerreichbar ist. Also begnügt man sich mit Feuerwehrleuten, die natürlich keine Ahnung vom Mechanismus der Fahrstühle haben, und warum sollten sie auch?
Natürlich geht die Welt nicht unter, wenn man ein bis zwei Tage zwischen dem achten und dem neunten Stockwerk eingeklemmt ist. Wenn es darum geht, Menschen einander näher zu bringen, dann ist eine steckengebliebene Fahrstuhlkabine geradezu der ideale Platz dafür. So manche dauernde Freundschaft mag da begonnen haben, Geschäfte wurden abgeschlossen, Baukontrakte unterzeichnet, Kinder gezeugt, wer zählt die Völker, kennt die Namen… Ich wage sogar die Behauptung, daß wir uns etliche blutige Kriege erspart hätten, wenn die Verhandlungen über die Autonomie der Palästinenser in einen steckengebliebenen Lift verlegt worden wären. Kurz, so ein Lift, ob er fährt oder steckt, hat unübersehbare Vorzüge. Vor allem in Wolkenkratzern und besonders für leidenschaftliche Nichtkletterer, wie ich einer bin. Die heutigen Fahrstühle sind überdies schnell wie der Blitz. Ein Knopfdruck und – huiii! – bist du am Dach des höchsten Hotels. Ein weiterer Knopfdruck und – hiuuu! – bist du irgendwo im Inneren der Erde, in einem tiefen Kellergeschoß oder einer unterirdischen Parkgarage oder sonstwo. Und da ist auch schon der Haken. Denn der Weg nach oben geht normalerweise reibungslos vor sich. Wenn du aber wieder hinunter willst, kommt der Moment, wo die Schwierigkeiten beginnen. Denn keiner hat mir bisher erklären können, welcher der vielen Knöpfe mich in jenes Geschoß befördert, in dem sich der Hotelausgang befindet.
Zugegeben, da ist zwar ein Knopf mit der Bezeichnung »E«, und es steht dir frei anzunehmen, daß damit das Erdgeschoß gemeint ist, doch darunter befindet sich ein weiterer Knopf mit einem »S«, und du beginnst zu schwanken. Ist damit vielleicht »Straße« gemeint? Oder ist es vielleicht das »P«, womit Parterre gemeint sein könnte? Oder bringt das »M«, wie Mezzanin, den Weg in die ersehnte Freiheit? Ich habe schon Hochhäuser erlebt, in denen zu den bisher erwähnten Buchstaben noch ein Knopf mit einem »H« zu finden war. Ich wagte ihn nicht zu betätigen aus Angst, daß mit dem »H« Hades gemeint sein könnte. Jene Fahrstühle, in denen es Knöpfe mit der Negativbezeichnung »1«, »-2« und »-3« gibt, will ich hier taktvoll übergehen.
Üblicherweise passiert folgendes: Man erledigt, was immer man im zehnten Stockwerk des neuen Luxushotels zu erledigen hat, stürzt anschließend in den Fahrstuhl und drückt hurtig einen Knopf mit einem der vielen Buchstaben des Alphabets. Natürlich hat man nicht Zeit, lange nachzudenken, weil man ohnehin schon vierzig Minuten zu spät für das Rendezvous mit Lefkowitz dran ist. Wer Lefkowitz kennt, weiß, daß dieser Gauner imstande ist, mir nichts, dir nichts davonzugehen.
Und während man noch diesem schwarzen Gedanken nachhängt, bleibt der Fahrstuhl irgendwo stehen. Man eilt heraus und kracht in einen Kellner, der ein volles Tablett auf den Boden fallen läßt. Inmitten der zerbrochenen Suppenterrine und den auf dem Fußboden dampfenden Nudeln erscheint der Chefkoch und brüllt:
»Was suchen Sie in der Küche, Sie Trottel?«
Der Trottel befindet sich unerklärlicherweise in der Etage mit der Aufschrift »-1«, wo die Luxushotels normalerweise ihre Küchen zu verbergen pflegen. In panischem Schrecken suche ich mich in den Fahrstuhl zu retten und stelle mit Entsetzen fest, daß er sich schon längst in einem anderen Stockwerk befindet. Ich trete einige Male gegen die dicht verschlossene Fahrstuhltür, doch der einzig sichtbare Erfolg sind einige Suppennudeln, die nunmehr an der Tür kleben. Und Lefkowitz ist vermutlich schon im Ausland.
Es erhebt sich die nicht unberechtigte Frage, wieso ein Knopfdrücker von einigermaßen durchschnittlicher Intelligenz nicht in die Lage versetzt werden kann, zu gegebener Zeit den richtigen Knopf zu drücken. Meiner Ansicht nach liegt es daran, daß man zu leicht geneigt ist, sich auf die Automatisierung zu verlassen. So ein moderner Aufzug fährt automatisch hinauf und hinunter, spielt automatisch dezente Musik, seine Türen öffnen und schließen sich automatisch. Ebenso automatisch drückt mein Finger auf den falschen Knopf.
Im Laufe der Zeit ist es mir gelungen, aus meinem Fahrstuhl in die verschiedensten Parkgaragen zu treten, in Lager, die nach unerwarteten Chemikalien dufteten, in Maschinenräume, die entweder die Luftzufuhr oder die Zentralheizung kontrollierten, in Großwäschereien und sonst noch allerhand. Vor einiger Zeit, als ein rumänischer Zirkus im Hilton-Hotel logierte, platzte ich in eine Gruppe von dressierten Seelöwen, die gerade gefüttert wurden. Wenn ich nicht irre, war der Knopf, den ich damals drückte, mit einem »F« behaftet. Vermutlich war damit »Fisch« gemeint.
Bei einer anderen Gelegenheit, als ich einige Stockwerke unter der Erde in einer Tischlerwerkstatt landete und in panischem Schrecken in den vierzehnten Stock zurückfuhr, traf ich den neuen Hotelmanager, der mir in meinem Fahrstuhl Gesellschaft leistete.
»Warum«, fragte ich ihn unwirsch, »warum in drei Teufels Namen könnt ihr nicht irgendwas Vernünftiges neben so einen blöden Knopf schreiben, wie zum Beispiel >Ausgang<?«
Der Blick des Managers streifte mich mit Verachtung:
»Verehrter Herr«, sagte er in berufsbedingt gedämpftem Tonfall. »Es ist das erste Mal, daß mir eine so dumme Beschwerde unterbreitet wird. Jedermann weiß, daß sich unterhalb des ersten Stockwerks die Hotelhalle befindet, und selbstverständlich ist dort auch der Ausgang zu finden. Hier sind wir schon, mein Herr…«
Er warf mir ein höhnisches Lächeln zu, stieg aus dem Fahrstuhl ins Freie und wurde von einem grünen Sportwagen überfahren.
Gibt es eine Lösung meines Problems? Eine Methode ist zum Beispiel die, wie weiland Hansel und Gretel Brotkrumen zu verstreuen, um ganz sicher zu gehen, daß man aus dem dunklen Wald den Heimweg findet. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, einen sorgfältigen Knopfdrucktest zu veranstalten, bevor man in die Höhe fährt. Dabei ist im Erdgeschoß jener Knopf zu finden, bei dem der Aufzug weder hinauf noch hinunter fährt. Er ist dann mit roter Farbe zu bezeichnen. Ich persönlich habe mich für das Feldenkrantz-Schritt-für-Schritt-Patent entschieden, das mir mein gleichnamiger Freund auf dem Totenbett verkauft hat. Der Modus ist denkbar einfach. Egal, in welch schwindelnder Höhe man einen Fahrstuhl betritt, man fährt zunächst vorsichtig nach unten und probiert Stockwerk für Stockwerk, Knopf für Knopf, jede Möglichkeit sorgfältig aus. Selbstverständlich muß man, wo immer der Lift hält, mit einem Fuß in der Tür erkunden, wo man sich befindet. Und so kommt man langsam aber sicher abwärts, bis man im Erdgeschoß landet. Oder im Schwimmbad. Oder im Leichenschauhaus.
Mit der Zeit gewöhnt man sich an alles. Wenn ich nicht im Erdgeschoß landen sollte, gehe ich eben schwimmen. Wenn ich im Leichenschauhaus ankomme, lege ich mich hin und schlafe. Wenn die Fahrt beim Ausgang endet, gehe ich aus. Aber das kommt sehr selten vor.
Was Setzmaschinen vermögen…
»Dieser Jankel bringt mich noch ins Grab!« fluchte Herr Grienbutter, Chefredakteur des »Täglichen Freiheitskämpfers«, lautlos in sich hinein. »Hundertmal hab’ ich ihm schon gesagt, daß bei verschiedenen Nachrichten auch die Titel verschieden gesetzt werden müssen, besonders wenn sie auf dieselbe Seite kommen. Und was macht Jankel? Er setzt die Titel >Gewerkschaft kündigt Neuwahlen an< und >USA von Teuerungswelle bedroht< in gleicher Größe und in gleicher Type nebeneinander! Es ist zum Verrücktwerden .«
Herr Grienbutter riß ein Blatt Papier an sich, um eine eilige Kurznachricht an Jankel hinzuwerfen – wobei er ihn, wie immer in Fällen offiziellen Ärgers, nicht mit dem kosenden Diminutiv anredete, sondern mit der korrekten Namensform: »Jakob – Titel verschieden (USA, Gewerkschaft)!« Und um sicherzugehen, daß der solchermaßen zurechtgewiesene Jakob die Botschaft auch wirklich bemerken und berücksichtigen würde, rahmte sie Herr Grienbutter mit dicken, schwarzen Strichen seines Filzschreibers ein. Dann warf er das Blatt zusammen mit dem Bürstenabzug in den Abgangs-Korb für die Setzerei und eilte aus dem Haus. Er war bei Spiegels zum Nachtmahl eingeladen und schon eine Viertelstunde verspätet. Als Herr Grienbutter am nächsten Morgen – wie üblich noch im Bett – die Zeitung öffnete, sank er, vor Schrecken fast vom Schlag gerührt, in die Kissen zurück. Von der ersten Seite des »Freiheitskämpfers« glotzte ihm in dickem, schwarzem Rahmen die folgende Todesanzeige entgegen:
Der Vorstand
Des Jüdischen Gewerkschaftsbundes
Zornbebend stürzte Herr Grienbutter in die Redaktion, wutschnaubend fiel er über Jankel her. Jankel hörte sich die Schimpftirade ruhig an und verwies auf Grienbutters eigenhändige Arbeitsnotiz, die er für den Druck ja nur geringfügig eingerichtet hatte. Der unterm Keulenschlag eines irreparablen Schicksals wankende Chefredakteur suchte das Büro des Herausgebers auf, um mit ihm eine Möglichkeit zu besprechen, wie man sich bei den Lesern des »Freiheitskämpfers« für den skandalösen Mißgriff entschuldigen könnte.
Zu seiner Überraschung empfing ihn der Herausgeber in strahlender Laune. Er hatte soeben von der Annoncenabteilung erfahren, daß bereits 22 hochbezahlte Traueranzeigen eingelaufen waren, die das unerwartete Hinscheiden Jakob Titels beklagten. Herr Grienbutter wollte kein Spaßverderber sein und empfahl sich schleunig.
Am nächsten Tag wimmelte es im »Freiheitskämpfer« von schwarzumrandeten Inseraten. Da hieß es etwa:
»Gramgebeugt geben wir den allzu frühen Tod unseres treuen Jakob Titel bekannt. Die Konsumgenossenschaft Israels.«
Oder: »Leitung und Belegschaft der Metallröhrenwerke Jad Eliahu betrauern das tragische Ableben Jakob Titels, des unerschrockenen Pioniers und Kämpfers für unsere Sache.«
Aber das alles hielt keinen Vergleich mit der folgenden Nummer aus, die um vier Seiten erweitert werden mußte, um die Zahl der Trauerkundgebungen zu bewältigen. Allein die »Landwirtschaftliche Kooperative« nahm eine halbe Seite in Anspruch: »Der Verlust unseres treuen Genossen Jakob (Jankele) Titel reißt eine unersetzliche Lücke in unsere Reihen. Ehre seinem Andenken!« Die Beilage brachte ferner das aufrichtige Mitgefühl der Drillbohrer zum Ausdruck. »Wir teilen euern Schmerz über den Verlust dieses besten aller Arbeiterfunktionäre«, und enthielt überdies einen peinlichen Irrtum:
»Den Titels alle guten Wünsche zur Geburt des kleinen Jakob. Familie Billitzer«.
Auch die anderen Morgenblätter waren mit entsprechenden Anzeigen gesprenkelt, ohne indessen dem »Freiheitskämpfer« Konkurrenz machen zu können. Der Chef des hochangesehenen »Neuen Vaterlands«, verärgert darüber, daß sein Blatt den Tod einer so hervorragenden Persönlichkeit des öffentlichen Lebens nicht als erstes gemeldet hatte, überließ den Nachruf seinem Sportredakteur. Dieser erfahrene Reporter durchstöberte ebenso gründlich wie erfolglos den Zettelkasten, stellte alle möglichen Recherchen an, die ihm von selten der Befragten nur dunkle Erinnerungen an den verewigten Jakob Titel einbrachten, und behalf sich schließlich mit einem sogenannten »Allround« – Nekrolog, der erfahrungsgemäß immer paßte:
»Jakob (Jankele) Titel, der zur Generation der >alten Siedler< unseres Landes gehörte, wurde während eines Besuchs in den Vereinigten Staaten plötzlich vom Tod ereilt und auf dem örtlichen Friedhof zur letzten Ruhe gebettet.
Titel, ein Haganah-Kämpfer der ersten Stunde, hatte sich praktisch in sämtlichen Sparten der Arbeiterbewegung betätigt. Schon auf der Jüdischen Hochschule in Minsk (Rußland), die er mit vorzüglichem Erfolg absolvierte, galt er als einer der führenden Köpfe der Studentenschaft und rief eine geheime zionistische Jugendgruppe ins Leben.
Ungefähr um die Jahrhundertwende kam >Jankele< mit seiner Familie ins Land, ging als Kibbuznik nach Galiläa und wurde einer der Gründer der damaligen Siedler-Selbstwehren. Später bekleidete er verschiedene Funktionen im Staatsdienst, sowohl daheim wie im Ausland. Nach einer erfolgreichen öffentlichen Laufbahn zog er sich ins Privatleben zurück und widmete sich den Problemen der Arbeiterorganisation. Er gehörte bis zu seinem Ableben der Verwaltungsbehörde seines Wohnortes an.«
Bekanntlich ehrt das Vaterland seine bedeutenden Männer immer erst, wenn sie tot sind. So auch hier. Auf einer Gedenk-Kundgebung zu Ehren Jakob Titels nannte ihn der Unterrichtsminister »einen tatkräftigen Träumer, einen Bahnbrecher unseres Wegs, einen Mann aus dem Volke und für das Volk«. Als der Männerchor von Givat Brenner zum Abschluß der Feier Tschernikowskys »Zionsliebe« anstimmte, wurde unterdrücktes Schluchzen hörbar. Das bald darauf fertiggestellte Gebäude der Gewerkschaftszentrale erhielt den Namen »Jakob-Titel-Haus«; da sich trotz längerer Nachforschungen kein lebender Angehöriger Titels gefunden hatte, übernahm der Bürgermeister von Tel-Aviv anstelle der Witwe den symbolischen Schlüssel. Unter dem Portrait des Verstorbenen in der großen Eingangshalle häuften sich die von den führenden Körperschaften des Landes niedergelegten Kränze. Das Bildnis selbst war ein Werk des berühmten Malers Bar Honig. Als Vorlage hatte ihm ein 35 Jahre altes Gruppenfoto aus den Archiven des Gewerkschaftsbundes gedient, auf dem Jakob Titel, halb verdeckt in der letzten Reihe stehend, von einigen Veteranen der Bewegung identifiziert worden war. Besonders eindrucksvoll fanden zumal die älteren Betrachter das von Bar Honig täuschend ähnlich getroffene Lächeln »unseres Jankele«.
Mit der Herausgabe der Gesammelten Schriften Jakob Titels wurde ein führender Verlag betraut, dessen Lektoren das Material in mühsamer Kleinarbeit aus alten, vergilbten Zeitungsbänden herausklaubten; die betreffenden Beiträge waren anonym erschienen, aber der persönliche Stil des Verfassers sprach unverwechselbar aus jeder Zeile.
Dann allerdings geschah etwas, woran der ganze, vielfältige Nachruhm Jakob Titels beinahe zuschanden geworden wäre:
Als die Straße, in der sich die Redaktion des »Freiheitskämpfers« befand, auf allgemeinen Wunsch in »Jakob-Titel-Boulevard« umbenannt wurde, brach Herr Grienbutter zusammen und klärte in einem Leitartikel die Entstehung der Titel-Legende auf. Ein Sturm des Protestes erhob sich gegen diesen dreisten historischen Fälschungsversuch. Auf der Eröffnungsfeier des »Jakob-Titel-Gymnasiums« erklärte der Regierungssprecher unter anderem: »Jakob Titel ist schon zu Lebzeiten diffamiert worden, und gewisse Taschenspieler der öffentlichen Meinung diffamieren ihn auch nach seinem Tod. Wir aber, wie alle ehrlichen Menschen, stehen zu Jakob Titel!«
Herr Grienbutter, der unter den geladenen Gästen saß, ließ sich durch diese persönliche Attacke zu einem Zwischenruf hinreißen; es sei lächerlich, rief er, das Geschöpf eines Druckfehlers zu feiern. Daraufhin wurde er von zwei Ordnern mit physischer Gewalt aus dem Saal entfernt und in Spitalpflege überstellt, wo er jedoch alsbald in Trübsinn verfiel, weil auch das Krankenhaus nach Jakob Titel benannt war. Nachdem er eines Nachts einen Tobsuchtsanfall erlitten hatte, mußte man ihn in eine Nervenheilanstalt einliefern. Unter der geduldigen Obsorge der Psychiater trat allmählich eine Besserung seines Zustands ein. Er begann sich mit den gegebenen Tatsachen abzufinden und wurde nach einiger Zeit als geheilt entlassen. In Würdigung seiner großen journalistischen Verdienste erhielt er im folgenden Jahr den »Jakob-Titel-Preis für Publizistik«.
Treibstoff mit Vitamin C
Es scheiterte an Juanito, dem minderjährigen Sohn des argentinischen Botschafters. In einem unbewachten Augenblick rannte der Knabe zu dem großen Tank, in den sich die Flüssigkeit ergoß, steckte den Finger hinein, leckte ihn ab und wiederholte das mehrere Male, bevor man ihn endlich wegzerren und einem rasch herbeigeholten Arzt übergeben konnte. Die Untersuchung blieb ergebnislos. Trotz gründlicher Analyse wurde nichts Nachteiliges entdeckt. Die Flüssigkeit, die sich aus den Leitungsrohren ergoß, war kein Benzin. Es war klarer, trinkfertiger Grapefruitsaft.
Der Skandal, der daraufhin losbrach, erschütterte das Land in seinen Grundfesten. Die Behörden suchten fieberhaft nach den Schuldigen, die Schuldigen machten die Behörden verantwortlich, Klagen und Gegenklagen jagten einander. Wie erst jetzt bekannt wurde, hatte sich der italienische Ingenieur kurz vor der Grapolin-Eröffnung ins Ausland abgesetzt, ohne eine Adresse zu hinterlassen. Das bot der sensationshungrigen Presse neue Gelegenheit zu Brand- und Hetzartikeln, an denen die Autorität der Behörden empfindlichen Schaden zu nehmen drohte. Einer dieser Artikel verstieg sich zu der Behauptung, daß das Produkt der Grapolin-Werke, also der dort erzeugte Grapefruitsaft, von minderer Qualität sei. Eine Verleumdungsklage auf 200.000 Shekel Schadenersatz war die offizielle Antwort. Auch sonst blieb die Regierung nicht untätig. Kommissionen und Unterausschüsse wurden eingesetzt, Berichte wurden erstattet, gelesen und verworfen. Nach wochenlangen hitzigen Debatten beschloß man, eine international anerkannte Autorität einzuladen, die ein bis zwei Jahre im Land bleiben und erforschen sollte, warum aus den Leitungsrohren kein Benzin herauskäme und was dagegen zu machen wäre.
Die internationale Autorität, ein amerikanischer Öl- und Kanonenbootexperte namens Joe Blowstine, verlangte sofort nach seinem Eintreffen die Grapolin-Werke zu sehen, trieb sich dort drei Tage lang herum, prüfte die Maschinen, inspizierte das Gelände und gab schließlich dem Generaldirektor des Unternehmens folgendes Ergebnis bekannt:
»Leider. Aus Grapefruits kann man kein Benzin machen.«
»Ja, schon gut«, erwiderte der Generaldirektor. »Aber trotzdem…«
»Was heißt hier trotzdem? Es ist unmöglich. Wenn Sie ungefähr zwei Drittel der Maschinen stillegen, können Sie mit dem Rest immerhin Grapefruitsaft erzeugen. Etwas anderes nicht.«
An dieser Stelle erhob sich der Generaldirektor, packte den Experten am Kragen, schüttelte ihn und sprach:
»Hören Sie. Auf solche Ratschläge verzichten wir. Wir haben in dieses Projekt Millionen und aber Millionen investiert, ganz zu schweigen von unserem Enthusiasmus, von unserer Energie und von den Propagandakosten. Und das alles für noch eine Grapefruitsaft-Fabrik? Davon haben wir schon eine ganze Menge. Hier müssen wir Benzin erzeugen. Und zwar aus Grapefruitsaft.«
»Unmöglich. Es geht nicht. Und jetzt lassen Sie mich gefälligst los.«
Der Handelsminister bot dem Experten, den er in sein Büro gebeten hatte, eine Zigarre an.
»Ich habe Ihre Expertise aufmerksam gelesen«, begann er, »und muß Ihnen gestehen, daß sie mich ein wenig enttäuscht hat. Ich beziehe mich da zum Beispiel auf die folgende, meiner Meinung nach doch etwas übertriebene Formulierung: >Die Errichtung der Anlage offenbart ein erschütterndes Ausmaß von Verantwortungslosigkeit, wie man ja überhaupt den ganzen Plan nicht nur als kindisch bezeichnen muß, sondern…<, und so weiter und so weiter. Halten Sie diese Ihre Einstellung für fruchtbar und konstruktiv? Wollen Sie behaupten, daß wir alle nichts als Dilettanten sind? Sie haben, verehrter Herr, für unsere Bemühungen kein einziges Wort der Anerkennung gefunden, kein einziges Wort, mit dem wir den Bau der Fabrik vor unseren Steuerzahlern rechtfertigen könnten. Ein derart undifferenziertes, um nicht zu sagen oberflächliches Urteil haben wir von einem so weltbekannten Fachmann wahrhaftig nicht erwartet. Sie scheinen sich über das Ausmaß der Enttäuschung, die Sie uns verursachen, kein richtiges Bild zu machen. Wenn Sie wüßten …«
Der Handelsminister konnte nicht weiterreden. Tränen liefen ihm über die Wangen.
»Aber was soll ich tun, Exzellenz?« murmelte der zutiefst betroffene Fachmann. »Es ist nun einmal so, daß man Benzin nicht aus Grapefruitsaft erzeugen kann.«
»Dann deuten Sie in Ihrem Bericht wenigstens an, daß wir an der Schwelle eines gewaltigen wissenschaftlichen Durchbruchs stehen.«
»Es tut mir leid – aber ich sehe nicht, wohin Sie durchbrechen wollen.«
Der Handelsminister schlug unvermittelt mit der Faust auf den Tisch.
»Wir werden Ihrem Sehvermögen schon nachhelfen«, brüllte er. »Adieu!«
Bald darauf sah sich Joe Blowstine gezwungen, sein Luxushotel zu verlassen und nach Jaffa zu übersiedeln, in ein kleines möbliertes Zimmer, von wo er nicht weit zur nächsten Autobusstation hatte. Das Regierungsauto, das ihm bisher zur Verfügung stand, wurde zu anderen Zwecken benötigt. Auch die Auszahlung des vereinbarten Gehalts stieß auf unvorhergesehene Buchungsschwierigkeiten. Der Fachmann ließ sich nicht kleinkriegen.
»Nein«, erklärte er auf Befragen, »es geht nicht. Aus Grapefruitsaft kann man kein Benzin machen.«
Die Gewerkschaft schickte ihn auf einen sechsmonatigen Entwicklungskurs, von dem man sich einiges erhoffte. Die Hoffnung erfüllte sich nicht, hingegen wiederholte sich die Formulierung:
»Es geht nicht. Es ist unmöglich, aus Grapefruitsaft Benzin herzustellen.«
Die folgende Woche verbrachte Joe Blowstine, von der Umwelt vollständig isoliert, im Negev. Dort suchte ihn der Generaldirektor der Grapolin-Werke auf.
»Nehmen Sie endlich Vernunft an, und schreiben Sie uns einen brauchbaren Bericht. Was haben wir Ihnen getan? Warum sind Sie überhaupt hergekommen? Wollen Sie uns vielleicht erpressen? Da kann ich Sie nur warnen, lieber Herr. Mit solchen Leuten werden wir noch fertig!«
Damit zog er ein Papier aus seiner Tasche und legte es vor den Experten hin; es hatte folgenden Wortlaut:
Ich halte die Grapolin-Werke für ein höchst erfolgversprechendes Unternehmen. Der Einfall, der ihnen zugrunde liegt, ist genial und wird zweifellos Früchte tragen. Möge der Allmächtige dieses Vorhaben segnen! Hochachtungsvoll
International anerkannte Autorität
»Unterschreiben Sie auf der punktierten Linie«, sagte der Grapolin-Direktor. »Nein«, sagte die international anerkannte Autorität.
Am nächsten Tag wurde Joe Blowstine auf dem Flughafen Lod verhaftet, als er sich gerade in der Toilette eines startklaren Flugzeugs einschloß. Man brachte ihn ins Gefängnis, wo er bis zur Ausarbeitung der Anklage verbleiben sollte. Die Klage lautete auf Wirtschaftssabotage verbunden mit Fluchtversuch. Nach einigen Tagen zermürbender Einzelhaft erschien abermals der Grapolin-Direktor, diesmal in Begleitung zweier breitschultriger eingeborener Fachleute.
»Also? Kann man aus Grapefruitsaft Benzin machen?«
»Eher noch Grapefruitsaft aus Benzin«, stöhnte Blowstine. Und auch der Zuspruch der beiden einheimischen Experten konnte ihn zu keiner Änderung seines Standpunkts bewegen.
Unter bisher noch ungeklärten Umständen gelang ihm einige Wochen später die Flucht. Das offizielle Kommunique begnügte sich mit der Feststellung, daß »der international anerkannte Öl- und Kanonenbootexperte Joe Blowstine um vorzeitige Lösung seines Vertrags gebeten« hatte und daß sein Bericht über die Grapolin-Werke »vom Handelsministerium noch geprüft« werde.
Seit einiger Zeit wird in den Grapolin-Werken synthetischer Grapefruitsaft hergestellt. Die Meinungen über die Qualität des Erzeugnisses gehen auseinander. Eine international anerkannte Autorität wurde eingeladen, sie zu prüfen.
Rezept für Kurzwelle
Um es kurz zu machen: Jankel funkte eine Kurzwellennachricht an den Flughafen Lydda. Ein Düsenflugzeug der EI- AI startete mit der SOS-Meldung nach Zypern, wo der Pilot von einem Kurier des israelischen Konsulats erwartet wurde, der sich sofort mittels Motorrad nach Luxemburg begab und von dort eine 500-Worte-Botschaft an den belgischen Umweltminister drahtete. Der ökologiebewußte Staatsmann stellte dem Londoner Korrespondenten von Radio Israel seinen persönlichen Sonderzug zur Verfügung, worauf der Korrespondent sofort nach Kopenhagen flog und einen dramatischen Rundfunk-Appell an die Weltöffentlichkeit richtete. Die Dachorganisation der kanadischen Judenschaft reagierte unverzüglich durch Verschiffung eines Ambulanzwagens nach Holland. Unter persönlicher Leitung des Polizeichefs von Rotterdam wurde der Wagen im Eiltempo quer durch Europa dirigiert, sammelte unterwegs 37 berühmte Internisten und Chirurgen auf und kam mit einem Bomber der amerikanischen Luftwaffe in Israel an.
Auf dem Weg nach Tel Aviv wurde der Konvoi durch die Teilnehmer des in Nathania tagenden Ärztekongresses verstärkt, so daß im Morgengrauen eine Gesamtsumme von 108 hochklassigen Medizinern vor meinem Wohnhaus abgeladen wurde. Das Geräusch der Autobusse und der übrige Lärm weckte Dr. Wasservogel, der aufgeregt die Stiegen hinunterlief. Ich nützte das aus, um ihn zu fragen, was ich gegen meine Magenschmerzen machen sollte. Er empfahl mir, in meiner Diät etwas vorsichtiger zu sein. So wurde mein Leben durch die auf Kurzwellen gestützte Solidarität der Welt gerettet. Aber beim nächstenmal setze ich mich direkt mit Königin Elisabeth in Verbindung, damit keine Zeit verlorengeht.
Mit der U-Bahn in die Steinzeit
Bei Einbruch der Dämmerung versammelten sich die Stammesangehörigen um das Lagerfeuer. Fast alle waren gekommen: Old Dad, Onkel Griesgram, die Fährtensucher, der Chronist und andere. Einige von ihnen gingen noch aufrecht, aber die meisten zogen es vor, sich auf allen vieren den Weg durch die Schutthaufen zu bahnen. Ihre Kleidung bestand aus Fetzen von Sackleinen und zerrissenen Decken, ihre stoppelbärtigen Gesichter waren mit dem gleichen weißgrauen Staub bedeckt, der in dicken Wolken über der verwüsteten Stadt Tel Aviv hing. Sie trugen Wattebäusche in den Ohren, und manche hatten sogar eine Art von Schleiern um ihre Köpfe gebunden, niemand wußte wozu. Vielleicht wollten sie sich gegen den Höllenlärm der Baggermaschinen auf der andern Seite des großen Berges abschirmen.
Das Lagerfeuer, um das sie hockten, befand sich im Hof eines verfallenen Hauses. Sie unterhielten die Flamme mit uralten Zeitungen und dem Holz geborstener Einrichtungsgegenstände. Jetzt warfen sie noch die Blechdosen und die Verpackungspapiere der Nahrungsmittel hinein, die ein Hubschrauber der Stadtverwaltung für sie abgeworfen hatte. Dann begannen sie zu kauen, wobei sie unartikulierte Laute einer animalischen Befriedigung von sich gaben.
»Fleisch«, grunzte Old Dad. »Echtes, gutes Fleisch…«
In Wahrheit grunzte er nicht, er röhrte. Aber solche Feinheiten in der Differenzierung menschlicher Ausdrucksweise waren längst verlorengegangen, seit das Toben der Drillbohrer aus dem nahe gelegenen Schacht der Untergrundbahn alles übertönte.
»Warum haben sie Fleisch für uns abgeworfen?« verlangte Onkel Griesgram laut schreiend zu wissen.
»Warum gerade heute?«
Old Dad formte seine Hände zum Trichter:
»Es ist die Wiederkehr des Gerichtstags! Der 6. Juli!«
Die anderen brachen in lautes Wehklagen aus. Der 6. Juli, so ging die Sage, war der Tag, an dem die Knesset den Antrag des Verkehrsministers angenommen und den Bau einer Untergrundbahn beschlossen hatte. Es war der Gerichtstag. Es war der Beginn des Zusammenbruchs.
»Old Dad«, baten mit schrillem Gekreisch die Kinder, »erzähl’ uns doch, wann das alles angefangen hat!«
Die Kleinen brauchten keine Watte mehr in den Ohren zu tragen. Sie waren bereits halb taub in der isolierten Enklave geboren worden, und der Höllenlärm ringsum war für sie ein ebenso selbstverständlicher Bestandteil der Natur wie für frühere Kinder das Gezwitscher der Vögel.
Old Dad kroch auf allen vieren zu den roten Kalkstrichen auf der gegenüberliegenden Mauer. Dort hatte sich auch der Chronist des Stammes hingelagert, ein weiser, vielerfahrener Alter, der in vergangenen Zeiten die Würde eines Universitätsprofessors bekleidet hatte.
»Eins … zwei… drei … «, zählte er und fuhr dabei mit zittrigem Finger über die roten Striche. »Es sind im ganzen zwölf Jahre vergangen…«
Seit zwölf Jahren waren sie vom Rest der Welt abgeschnitten. Old Dad erinnerte sich noch ganz genau:
»Damals ging’s los«, brüllte er. »Damals begann die Verkehrsmisere in Tel Aviv alle Grenzen zu übersteigen, und die Herren der Stadtverwaltung beschlossen, zum Wohle der Bevölkerung eine Untergrundbahn zu bauen. Sie kauften Maschinen. Viele, viele Maschinen … riesige Bulldozer … Traktoren… Krane… Drillbohrer … und sie gruben und gruben und gruben… Tag und Nacht… ohne Unterbrechung …«
»Wo, Old Dad? Wo gruben sie?«
»An den Kreuzungen. An den Straßenübergängen. Jenseits des großen Berges, diesseits der hohen Schutthalde. Tiefer und tiefer gruben sie und warfen zu beiden Seiten das Erdreich auf, bis wir eines Morgens die Straße nicht mehr überqueren konnten. Wir waren gefangen. Wir saßen in der Falle. Der Ring des Untergrundbettes hatte sich um uns geschlossen. Im Rundfunk hörten wir, daß der Verkehrsminister versprochen hatte, uns zu evakuieren.«
»Evakuieren?« fragten die Kinder im Chor. »Was ist das?«
»Uns zu retten. Uns herauszuholen. Wir warteten und warteten, aber nichts geschah. Nach einiger Zeit verstummte das Radio. Der elektrische Strom versagte, die Wasserleitungsrohre barsten, Sturzbäche ergossen sich über die Gegend, rissen die Telefonmasten um ... höher und höher stiegen die Berge von Schutt und Trümmern … und über allem der ständig wachsende Lärm der Maschinen. Viele von uns verloren ihr Gehör, die Nahrung ging uns aus, wir tranken Regenwasser.«
»Warum seid ihr nicht weggelaufen, Old Dad?«
»Weggelaufen?« Old Dad nickte wehmütig vor sich hin und deutete auf eine armselige Lumpengestalt, die in der Ecke des Hofes kauerte.
»Er hat’s versucht, der Kletterer. Er wollte weglaufen.«
Der als »Kletterer« Bezeichnete klappte mühsam das Lid seines linken Auges hoch. Auf seinem ausgemergelten Gesicht erschien ein idiotisches Grinsen. Mit dröhnender Stimme nahm Old Dad seine Erzählung auf:
»Vor undenklich langen Zeiten, als man noch nichts von der Zerstörung ahnen konnte, war der Kletterer ein berühmter, in den europäischen Alpen geschulter Hochtourist. Und deshalb wähnte er, den großen Schuttgipfel übersteigen zu können, damals, als man hinter dem Berg noch die Pfeiler des Elektrizitätswerkes sehen konnte, die mittlerweile längst im Untergrundschacht verschwunden sind. Eines Morgens also hatte der Kletterer sich auf den Weg gemacht, in voller Hochgebirgsausrüstung, mit Seilen und Pickeln und Nahrungsvorräten für eine Woche. Es hieß, daß er sich bis zur nächsten Kreuzung durchgeschlagen hätte, aber dort brach er sich den Knöchel, als er gegen ein im Schutt verborgenes Parkometer stieß. Trotzdem setzte er die gefährliche Gratwanderung fort, um in die freie Welt zu gelangen. Es glückte ihm nicht. Von einem der Kämme des großen Berges stürzte er viele Klafter tief in den Abgrund und verlor das Bewußtsein. Als er erwachte, war er stocktaub. Die Fährtensucher fanden ihn, an ein zerbrochenes Kanalgitter geklammert, das er offenbar für eine Gletscherspalte hielt. Von Zeit zu Zeit jodelte er.«
»Wieso hat man ihn überhaupt gefunden, Old Dad?«
»Die Fährtensucher machen sich jeden Tag auf den Weg«, erklärte der Alte mit gütigem Brüllen. »Sie suchen nach einem Pfad, nach einem Paß, der uns eines Tags in die Freiheit führen könnte…«
Auf der Ruine eines nahe gelegenen Hauses tauchten in diesem Augenblick zwei junge Fährtensucher auf, die sich an Stricken vorsichtig zur Spitze eines ragenden Schutthaufens herabließen und ein Signalfeuer entzündeten. Es stellte die letzte Verbindung des Stammes zur Außenwelt dar, seit die Brieftauben im Staub erstickt waren.
Von einem weiter entfernten Trümmerberg antworteten Blinkzeichen: große Flamme – kleine Flamme – groß – klein – klein – groß.
»Der Bürgermeister«, dechiffrierte Old Dad, »verspricht… die Arbeit… zu beschleunigen…«
Über der Enklave erschien ein amtlicher Hubschrauber. Er versorgte die Eingeschlossenen mit koscherer Verpflegung, neuen Wattevorräten und »Letzten Mahnungen« der Steuerbehörde.
»Old Dad«, schrien die Kinder, »werden wir nie von hier wegkommen?«
Old Dad gab keine Antwort. Er selbst, das war ihm klar, würde den Tag nicht mehr erleben. Aber den Kleinen würde es vielleicht noch vergönnt sein, in der Untergrundbahn von Tel Aviv zu fahren. Vielleicht. Wer weiß.
Computer auf Verbrecherjagd
Jetzt, da die geheimnisvollen Morde im Supermarkt endlich aufgeklärt sind und der Mörder für alle Zeiten hinter Schloß und Riegel sitzt, muß die brillante Computerarbeit gelobt werden, die schon nach knapp zwei Jahren zur Verhaftung des Verbrechers führte. Die Fakten sind bekannt. Der Täter betrat an jenem schicksalhaften Tag den Supermarkt und suchte nach Hustenbonbons. Als er keine fand, zog er eine Maschinenpistole hervor und erledigte dreizehn Kunden und eine Kassiererin. Dann drehte er sich um und ging davon. Die Kriminalpolizei setzte sofort den Zentralcomputer ein. Es war – wie einige Spezialisten später zugaben – so ziemlich die schwerste Aufgabe, mit der er je betraut wurde.
Lange Zeit schien es, als ob der Killer kein einziges Indiz hinterlassen hätte. Doch dann, im letzten Moment, kurz bevor man den Fall zu den Akten legen wollte, tauchte das Beweisstück auf, das die Polizei auf die Spur brachte.
Einer der erfahrensten Beamten fand ein langes, weißes Haar auf einer Dose veredelten Zwetschgenkompotts im untersten Fach eines Regals, und hier setzte der Computergigant zu einer logischen Kette von Schlußfolgerungen an.
Das weiße Haar, so folgerte er messerscharf, deutete auf eine ältere Person hin. Aus seiner Länge war zu schließen, daß der ehemalige Besitzer in finanziellen Nöten sein müßte, da er nicht in der Lage war, regelmäßig zum Friseur zu gehen. Daß dieses Haar ausgerechnet auf einer Dose Zwetschgenkompott klebte, wies weiter darauf hin, daß der Verbrecher unter Verstopfung leiden müsse. Darüber hinaus konnte man annehmen, daß jemand, der sich aus einem Regal ganz unten bedient, klein und kurzsichtig ist. So zog der Computer das Netz immer enger. Aus den vorhandenen Softwaredaten erhielten die Fachleute ein Phantom auf dem Bildschirm: einen älteren, kleingewachsenen, kurzsichtigen und schäbig gekleideten Mann mit strumpfbedecktem Gesicht, dessen verkrampfter Ausdruck von einem trägen Stuhlgang herrührte. Das Bild des Täters wurde erst in der Presse veröffentlicht, kurz danach im Fernsehen gezeigt. Die Bevölkerung wurde ersucht, die Polizei bei der Verbrecherjagd zu unterstützen. Innerhalb weniger Tage meldeten sich bei den Behörden 327 Anrufer, die den Verdächtigen erkannt hatten. 321 davon behaupteten, es handle sich um den Bürgermeister von Jerusalem. Dieser hatte jedoch für die fragliche Zeit ein hieb- und stichfestes Alibi. Daher konzentrierte man sich auf die übrigen sechs Verdächtigen.
Sie wurden im Hof des Polizei-Hauptquartiers in eine Reihe gestellt, und etliche Stammkunden des Supermarkts wurden aufgefordert, den Mörder zu identifizieren. Im Anschluß daran wurden drei Stammkunden festgenommen, welche ihrerseits von den Verdächtigen identifiziert wurden.
Am nächsten Tag wurde der spektakuläre Fall vom Spezialcomputer endgültig aufgeklärt. Auf dem Polizeirevier erschien nämlich eine blutjunge Bardame, die gegen die versprochene Belohnung ihren Freund, den Supermarkt-Killer, anzeigte. Es handelte sich um einen dünnen, hochgeschossenen, kurzgeschorenen jungen Strolch, der sich geweigert hatte, ihr ein Paar Ohrringe zu kaufen.
Made in Japan
Sie wollten schlicht und einfach von der Welt als Sieger, als Amerikaner betrachtet werden. Das ist letzten Endes nicht verboten. Eines Tages beschloß Japan, den Uhrenweltmarkt unter die Lupe zu nehmen, und es begann, Schweizeruhren herzustellen, die genauso aussahen, genauso exakt liefen und genauso glänzten, allerdings nur die Hälfte kosteten. Die Fabrik wurde natürlich Citizen genannt, um die gelblichen Elemente des Mechanismus zu vertuschen. Danach entdeckten die Japaner Taschenrechner und Videogeräte. Und die Welt wurde im Einheitsrhythmus eines selbstverständlich ebenfalls in Japan hergestellten Metronoms mit diesen elektronischen Wundern überflutet, die sich im Vergleich mit europäischen Erzeugnissen als ebenbürtig erwiesen. Vielleicht deshalb, weil auch die europäischen Erzeugnisse in Japan hergestellt werden. Zumindest ihre Innereien, der Mechanismus innerhalb der schneeweißen Hülle.
Und dennoch wurde der Westen allmählich etwas nervös angesichts dieser Eindringlinge, die alles ein wenig besser, ein wenig früher und sehr viel preiswerter machen. Was mag wohl ihr Geheimnis sein, fragte sich die freie Welt in berechtigter Panik, genügt es denn, einen Krieg zu verlieren, um so einen industriellen Aufschwung zu erleben, oder braucht man noch etwas darüber hinaus? Ist etwa, wie beim Fernsehen, die Farbe ausschlaggebend: schwarz-weiß nein, farbig ja? Einige westliche Gesellschaften, deren Bankrott unmittelbar bevorstand, legten mit letzten Kräften Rechenschaft vor sich selbst ab und griffen zur Statistik. Dabei erreichten sie Zahlen, die das Geheimnis in grellem Licht, wie das eines Heliumscheinwerfers, erscheinen ließen. Im holländischen Riesenwerk Philips, beispielsweise, stellen 1200 gut ausgebildete Arbeitskräfte rund 320.000 Fernsehröhren jährlich her. In dem vergleichbaren japanischen Werk wird im gleichen Zeitraum nur eine Viertelmillion Fernsehröhren von 168 Arbeitern hergestellt. In Worten: einhundertachtundsechzig. Weitere Fragen?
Darin besteht also der große Vorsprung dieser asiatischen Hundesöhne. Sie führen einen unlauteren Wettbewerb, sie arbeiten während der Arbeitszeit. Das ist so eine Art blöder Tradition bei ihnen, das Erbe fanatischer Vorfahren, fossiler religiöser Gesetze. Diese japanischen Eindringlinge haben nicht so viel Freizeit oder Feiertage wie wir. Bei ihnen werden an Wochenenden keine zwischen zwei Feiertagen liegende Werktage überbrückt. Bei ihnen werden Brücken gebaut. Furchtbar – rauft sich der Westen die Haare –, wie kann man mit einem Land konkurrieren, dessen Gewerkschaften so schwach sind?
Der Wildwest hat recht. Mit ihnen ist kein Wettbewerb möglich. Langsam, aber sicher zeichnet sich Japan in den Augen der Menschen als eine gehobene Rasse ab, und nicht unbedingt im Einklang mit den Kolonialgesetzen des weißen Mannes. Bei den Japanern ist alles nur eine Frage des Beschlusses. Des Beschlusses nämlich, welcher Markt im kommenden Jahr erobert werden soll.
Eines trüben Abends beschloß beispielsweise der Besitzer einer armseligen Werkstatt auf einer kleinen Insel, das bereits verstorbene Zweiradvehikel – zu Lebzeiten »Motorrad« genannt – zu neuem Leben zu erwecken. Er veränderte die Welt gleich in zweifacher Hinsicht. Zunächst brachte er diese lauten Monster auf die Straßen zurück, zweitens borgte er sich nicht wie üblich eine amerikanische Tarnung, sondern riskierte den eigenen Namen. Honda. Der Rest ist Historie. Oder Hysterie, je nach Standpunkt. Seit einem Jahrdutzend gelten die internationalen Motorradrennen als interner japanischer Wettkampf. Wird nun Suzukis Maschine gewinnen, oder wird es Kawasaki oder Yamaha sein, das ist die Frage. In den letzten Jahren begann sich das Werk Yamaha auch für andere Artikel zu interessieren und wurde nebenbei zu einem der führenden Orgel- und Klavierhersteller der Welt. Eine Frage des Beschlusses, wie gesagt. Der Pianist Arthur Rubinstein erzählte mir, das Philharmonische Orchester Tokio sei eines der besten der Musikwelt. Eines Tages beschloß es schlicht und einfach, eben wunderbar zu spielen, und da wird eben wunderbar gespielt. Auch ihre Filme sind vernichtend geworden. Vor ca. 50 Jahren kopierten sie die Hollywood-Schnulzen, heute läuft es in umgekehrter Richtung. Von dem berühmten »Rashomon« produzierten die Amerikaner bisher drei eigene Imitationen. »Die sieben Samurai« übernahm man in Hollywood mit stammelnden Dankesworten und verwandelte sie in »Die glorreichen Sieben«… Jetzt kam Subaru anstelle des Samurai. Das war der Augenblick, in dem den westlichen Imperien der Atem stockte und die Augen zu zwinkern begannen. Die Japaner hatten beschlossen, von zwei auf vier Räder umzusteigen und eigene Automobile herzustellen. »Wir haben gut zehn Jahre Vorsprung«, trösteten sich die Produktionsspezialisten in Detroit, »Autos sind weder Transistorgeräte noch Kameras, nicht einmal Kopiergeräte«. Es dauerte ganze zwei Jahre. Dann erschienen die Inserate mit den unmöglichen Namen wie Datsun, Toyota, Mazda und so fort. Heute befinden sich alle anderen Autohersteller in einer schweren psychologischen Krise. Volkswagen entläßt Arbeiter am laufenden Band, Chrysler versinkt in Schulden, Ford weist zum Jahresschluß ein Defizit von 1,5 Milliarden Dollar auf – und Mitsubishi kommt erst jetzt in Schwung. Das japanische Auto ist hübscher, schneller, besser, preiswerter und und und. Sie sind der Konkurrenz stets einen kleinen Schritt voraus. Honda hat vor kurzem den ersten Kleinstwagen mit Servolenkung herausgebracht, Mazda stellt die revolutionären Wankelmotoren her .
Wie kommt es? – fragt man sich in Industriellenklubs und auf sozialistischen Kongressen – wie kommt es, zum Teufel noch mal, daß sie so erfolgreich sind, während wir doch größer und weißer sind? Vor 80 Jahren wußten diese armen Schlucker nicht einmal, wie eine Flachzange aussieht, und heute produzieren sie automatisch Automaten für die automatische Produktion .
Was tun? Wirklich? Mehr arbeiten kommt wegen Marx und Spencer nicht in Frage, die Produktionskosten senken kann man wegen der Gewerkschaften nicht. Übrig bleiben Schutzzölle, das heißt, Japan zu verbieten, sämtliche Lokalmärkte durch die hohe Qualität seiner Produkte zu zerstören. Allerdings ist es etwas peinlich, sich vor diese lächelnden Gelben zu stellen und ihnen zu sagen: Hört mal zu, aus familiären Gründen sind wir leicht in Verzug geraten … Vorerst versucht jedoch der Westen noch, sein Gesicht zu wahren:
Ein wenig Verständnis, bitte – flüsterten sie diesen anderthalb Meter großen Riesen ins Ohr – beherrscht euch, in Gottes Namen. Beschränkt von euch aus eure Ausfuhren, sonst bricht bei uns mit ohrenbetäubendem Lärm alles zusammen. Wir haben Familie, Kinder, erbarmet euch unser, bitte … Japan besitzt nicht ein einziges Körnchen an Naturschätzen, alles muß im Ausland gegen harte Devisen erworben werden. Bald werden sie den ersten Platz unter den Stahlproduzenten der Welt einnehmen. Ärgerlich, nicht? Gerüchten zufolge erwägen die Führer der freien Welt, bei verzweifelten Maßnahmen Hilfe zu suchen. Ähnlich wie die Deutschen nach Ende des Ersten Weltkrieges Lenin in einem geschlossenen Waggon in das zaristische Rußland schmuggelten, beabsichtigen sie angeblich, einige Streikexperten des israelischen Gewerkschaftverbands nach Japan einzuschleusen, um dort wirksame Betriebsräte zu organisieren. Anders seien sie nicht zu bremsen, lautet die allgemeine Ansicht.
Inzwischen flattern die Nerven. Beruft der Generaldirektor von Toshiba oder Sanyo das Direktorium zur Besprechung der Programme für das folgende Jahr ein, bleibt in den Apotheken Europas nicht eine einzige Beruhigungstablette übrig. Der verschleierte Blick wandert über die Märkte: »Nein!« schreien die Kaugummihersteller überall auf. »Bitte, Kaugummi nicht, keinen Kaugummi herstellen!« Denn man weiß, wie es weitergehen würde. Der japanische Kaugummi kommt in einem Papier verpackt, das an dem Gummi nicht kleben bleibt, und er enthält Vitamine. Er behält seinen Geschmack über zwölf Stunden lang und spuckt sich dann von selbst aus. Hilfe! Es hängt lediglich von einem Beschluß ab. Widerstand ist aussichtslos. Wird heute in Italien eine neue Badewanne auf den Markt gebracht, die Badeöl ausscheidet und mittels eines Thermostats die Wasserwärme konstant hält, so erscheinen morgen in Italien Badewannen von Mitsubishi, die alle diese Funktionen auch haben, darüber hinaus eine Reisegeschwindigkeit von dreißig Stundenkilometern bieten und Puccinis Opern in Quadrophonie spielen…
Angeblich soll eine kleine Fabrik in Nagasaki kürzlich mit der Herstellung von Sacher-Torten begonnen haben, die nach Wien exportiert werden. Sie sollen schmackhafter sein, sagt man.
Die Welt ist völlig entsetzt, beschämt und verzweifelt. Im Laufe der Jahre haben sich die Menschen daran gewöhnt, daß an der Unterseite eines jeden hübschen, ausgeklügelten und preiswerten Artikels »Made in Japan« steht, manchmal auch »in Hongkong« oder »in Taiwan«, sofern hier eine Zusammenarbeit mit Japan vorliegt.
Es geht noch weiter. In den letzten Jahren schmuggelte sich ein neues Modell der deutschen Opel-Werke namens Manta in den Automarkt hinein. Merkwürdiger Name, was? Er klingt so exotisch. Und das ist wahrlich die Endphase der technologischen Entwicklung im Westen. Man borgt sich bereits japanische Namen, um das Vertrauen der Käufer zu gewinnen. Bald bringt Volvo sein Modell »Coyotta« auf den Markt, und General Motors bereitet insgeheim den Schlager der nächsten Saison vor, den typischen amerikanischen Sportwagen mit dem Namen »Pishimishi«. Der Verfasser dieser Zeilen nimmt seine in Tokio gedruckten Bücher in die Hand und betrachtet seine Humoresken, die in jenen merkwürdigen Schriftzeichen von oben nach unten laufen. Großer Gott, sagt er in seinem Innersten, ich fürchte, daß es in japanisch besser ist, es muß in japanisch besser sein.
Die Bombe für alle
Schulz hielt mich an der Ecke Arlosoroffstraße an:
»Nehmen Sie mich mit?« fragte er, »ich muß dringend zur Post .«
Ich ließ ihn einsteigen. Schulz war sehr aufgeregt. Ich fragte ihn, was los sei.
»Fragen Sie mich nicht! Mein Schwager hat mir aus Deutschland eine Atombombe geschickt.«
»Was?«
»Ja, entsetzlich, nicht wahr? Ich habe zwar in einer Zeitschrift gelesen, daß es in Deutschland ein Verfahren gibt, das es jedermann möglich macht, Atomwaffen einfach und billig herzustellen. Aber so etwas verschickt man doch nicht per Post!«
»Sehr merkwürdig, muß ich sagen.«
»Neuerdings sieht es so aus, daß sich tatsächlich der kleine Mann die Bombe leisten kann. Sehen Sie, was mein Schwager schreibt: >P. S.<, schreibt Friedrich da, >Ich habe auch eine kleine Überraschung für Dich. Per Luftpost geht heute eine Atombombe an Dich ab. Alles Gute!<«
»Er übertreibt.«
»Friedrich war schon immer großzügig«, sagte Schulz, »aber was soll ich mit der Bombe anfangen?«
»Weiß ich auch nicht. Ich habe noch nie eine gehabt.«
»Josepha macht mich ganz verrückt. >Ich will keine Atombomben im Haus<, schrie sie mir nach, als ich das Haus verließ, >ich habe genug Ärger mit dem Kleinen!< Weiß Gott, sie hat recht. Ich sehe es selbst nicht gern, wenn Danny mit einer Atombombe spielt. Da könnte ich für nichts garantieren. Er nimmt nämlich alles auseinander, was ihm in die Finger kommt. – Und außerdem: wo soll ich die Bombe aufbewahren? Im Kühlschrank vielleicht?«
»Ist sie groß, Ihre Bombe?«
»Keine Ahnung. Ich bin schließlich kein Fachmann. Ich werde die Gebrauchsanweisung lesen. Jedenfalls hoffe ich, daß er nicht das größte Modell gekauft hat. Unser Kühlschrank ist nämlich sehr klein. Aber Josepha will sowieso einen neuen. Eines können Sie mir glauben, wenn Friedrich nicht so empfindlich wäre, würde ich ihm die Bombe sofort zurückschicken. Wer braucht schon eine Atombombe? Glauben Sie, ich darf sie ausprobieren?«
»Wenn Sie die richtigen Beziehungen haben…«
»Ich weiß nur, daß ich noch eine Menge Ärger kriegen werde. Sie wissen ja, wie unsere Nachbarn sind, die halten uns jetzt schon für eingebildet. Deshalb kann ich es Josepha nicht übelnehmen, wenn sie die Bombe loswerden will. >Verkauf sie doch<, sagte sie. Wären Sie vielleicht interessiert?«
»Nicht direkt.«
»Schon gut. Josepha meint, die Regierung würde sie uns gern abkaufen. Aber ich antwortete ihr: >Das wäre ein schönes Geschäft. Und soll ich meinem Schwager erzählen, wenn er uns besucht und fragt: Wo ist die Bombe, die ich euch geschickt habe? – Die habe ich verkauft Friedrich.<?«
»Dann verkaufen Sie sie eben nicht.«
»So einfach ist das auch nicht. Es ist eine große Verantwortung dabei und viel Schererei. Zunächst einmal die Teilnahme an all diesen Abrüstungskonferenzen. Das ist doch absurd. Wer hat schon Zeit für solchen Unsinn?«
»Amerika, China, England, Frankreich«, begann ich in alphabetischer Reihenfolge, »die Sowjetunion und Schulz.«
»Nein, ich fahre nicht hin.«
»Warum nicht?«
»Ich bin zu schüchtern. Und ich kann keine Reden halten. Davon abgesehen habe ich nur eine einzige Bombe. Was werden sie also von mir verlangen? Daß ich meine Bombe vernichten soll. Ich weiß doch, wie die sind. Aber ich mach nichts kaputt. Wer sagt mir, daß die Chinesen ihren Bombenvorrat auch vernichten, stimmt’s?«
»Stimmt.«
»Glauben Sie mir, diese deutsche Erfindung stellt die ganze Welt auf den Kopf. Ein normaler Mensch kann die Kosten gar nicht aufbringen.«
»Was für Kosten?«
»Denken Sie nur an die Versicherung. Ich kann unmöglich das Risiko einer Explosion der Bombe in meinem Haus auf mich nehmen. Und wenn die Bombe kaputtgeht? Wer soll sie reparieren? Unser Klempner vielleicht?«
»Warum sollte sie kaputtgehen? Sie ist doch brandneu?«
»Ich nehme an, sie hat ein Jahr Garantie. Aber in der Regel gelten solche Garantien nicht bei Naturkatastrophen oder Krieg. Es ist einfach lächerlich – denn wann benutzt man schließlich eine Atombombe? Im Krieg!«
»Wollen Sie sie denn wirklich benutzen?«
»Was denn sonst?«
»Wie stellen Sie sich die Beförderung vor?«
»Per Post.«
Schulz bekam sich wieder in den Griff.
»In Wirklichkeit ist es mir egal«, sagte er. »Dann habe ich eben eine Bombe im Haus. Die Großmächte benutzen sie ja auch nicht. Ich werde sie aufheben – für alle Fälle. Wenn Sie’s genau wissen wollen, ist der Gedanke, eine Bombe im Haus zu haben, ein schönes Gefühl.«
»Warum?«
»Ich weiß es selber nicht. Ich fühle mich wohl dabei. Es verschafft einem eine Menge Selbstbewußtsein. Vorausgesetzt, Danny findet sie nicht…«
Wir waren am Paketschalter angekommen. Schulz bezahlte 46 Shekel Zoll und 26 Shekel Luxussteuer.
»Vorsicht«, warnte er die Beamten, »da drin ist ein Bombe.«
Das Paket war klein. Zwei Polizisten halfen uns beim Öffnen. Mit angehaltenem Atem holten wir eine in allen Farben schillernde Geschenkpackung hervor, auf der zu lesen stand:
»Lang lebe das Atom! Eine perfekte Nachbildung der Atombombe inklusive Blitz und Knall… Ein Spaß für Kinder und Erwachsene!«
»Friedrich ist verrückt«, schnaubte Schulz, »das ist für Danny zum Geburtstag.« Dann fügte er mit träumerischem Blick hinzu: »Und ich hatte mich schon so an den Gedanken gewöhnt.«